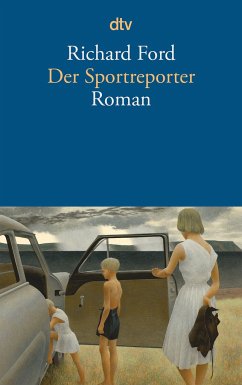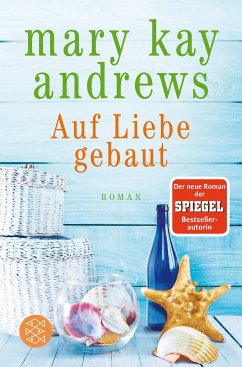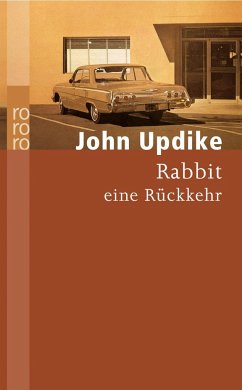Nicht lieferbar

Fiskadoro
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Fiskadoro - Eine erschütternde Vision der Menschheit nach dem atomaren EndschlagZwei Generationen nach der nuklearen Apokalypse vegetieren auf den Florida Keys die letzten Überreste der Zivilisation vor sich hin. Inmitten dieser postapokalyptischen Welt kämpfen Menschen wie Mr. Cheung ums nackte Überleben, während sich primitive Gesellschaften wie die Sumpfleute, die Israeliten und die Fischer neu formiert haben. Der junge Fiskadoro, aufgewachsen in einer Gemeinschaft von Fischern, steht stellvertretend für eine Generation, die in den Trümmern der untergegangenen Welt nach Sinn und Iden...
Fiskadoro - Eine erschütternde Vision der Menschheit nach dem atomaren Endschlag
Zwei Generationen nach der nuklearen Apokalypse vegetieren auf den Florida Keys die letzten Überreste der Zivilisation vor sich hin. Inmitten dieser postapokalyptischen Welt kämpfen Menschen wie Mr. Cheung ums nackte Überleben, während sich primitive Gesellschaften wie die Sumpfleute, die Israeliten und die Fischer neu formiert haben. Der junge Fiskadoro, aufgewachsen in einer Gemeinschaft von Fischern, steht stellvertretend für eine Generation, die in den Trümmern der untergegangenen Welt nach Sinn und Identität sucht.
In seinem verstörenden dystopischen Roman Fiskadoro entwirft Denis Johnson eine eindringliche Vision vom Zustand der Menschheit nach dem Ende der Zivilisation. Mit poetischer Kraft und schonungsloser Klarheit zeichnet er das Bild einer fremdgewordenen Welt, in der die letzten Fragmente des Menschlichen zu erlöschen drohen.
"Es ist ein fremder Abgrund, in den Johnson einen reißt. Sich ihm entziehen allerdings kann man kaum." (Welt)
Zwei Generationen nach der nuklearen Apokalypse vegetieren auf den Florida Keys die letzten Überreste der Zivilisation vor sich hin. Inmitten dieser postapokalyptischen Welt kämpfen Menschen wie Mr. Cheung ums nackte Überleben, während sich primitive Gesellschaften wie die Sumpfleute, die Israeliten und die Fischer neu formiert haben. Der junge Fiskadoro, aufgewachsen in einer Gemeinschaft von Fischern, steht stellvertretend für eine Generation, die in den Trümmern der untergegangenen Welt nach Sinn und Identität sucht.
In seinem verstörenden dystopischen Roman Fiskadoro entwirft Denis Johnson eine eindringliche Vision vom Zustand der Menschheit nach dem Ende der Zivilisation. Mit poetischer Kraft und schonungsloser Klarheit zeichnet er das Bild einer fremdgewordenen Welt, in der die letzten Fragmente des Menschlichen zu erlöschen drohen.
"Es ist ein fremder Abgrund, in den Johnson einen reißt. Sich ihm entziehen allerdings kann man kaum." (Welt)