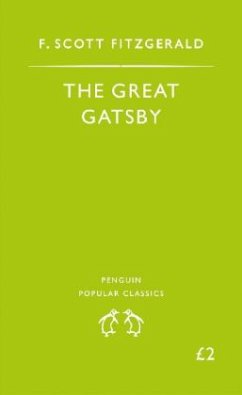Fast gleichzeitig erscheinen vier neue Übersetzungen des "Großen Gatsby". Auch wenn die Flut urheberrechtliche Gründe hat, enthält sie doch eine Botschaft: F. Scott Fitzgeralds Meisterwerk ist der Roman unseres materialistischen Zeitalters.
F. Scott Fitzgerald hat mit seinem bedeutendsten Roman kein Geld verdient. "Der große Gatsby", erschienen 1925 in New York, verbreitete sich in den darauffolgenden fünfzehn Jahren in weniger als 23 000 Exemplaren. Wir wissen das, weil 1940, als Fitzgerald an seinem dritten Herzinfarkt starb, noch einige Stück der zweiten Auflage am Lager waren. Die Nachrufe fielen entsprechend herablassend aus, sie galten einem ehemaligen Star, dessen Ruhm längst verblasst war.
Niemand ahnte, dass "Gatsby" sich schon kurz darauf in den Jahrhundertklassiker der amerikanischen Literatur verwandeln würde. Die erste deutsche Übersetzung war 1928 erschienen, die zweite, von Walter Schürenberg, folgte 1953 und blieb die nächsten fünfzig Jahre der maßgebliche Text. Dann warfen sich plötzlich vier Verlage in den Wettbewerb um die attraktivste Neufassung. Schon 2006 legte Bettina Abarbanell bei Diogenes die erste Neuübersetzung vor. (Der Unterzeichnete hatte das Vergnügen, dazu ein Nachwort beizusteuern.) Letztes Frühjahr erschien bei dtv "Der große Gatsby" in der Version von Lutz-W. Wolff, in wenigen Tagen folgt der neue "Gatsby" von Reinhard Kaiser (Insel), und für nächsten Januar ist beim Reclam Verlag die Übersetzung von Hans-Christian Oeser angekündigt: renommierte Namen im Wettbewerb um ein neues Publikum.
Mit dem Erlöschen des Urheberrechts im Jahr 2010 ist das vierfache Angebot dieses modernen Klassikers kaum ausreichend erklärt. Es lohnt sich, den "Großen Gatsby" als Bewusstseinsbild einer krisengefährdeten Epoche zu lesen, und weil solche Begriffe im Roman selbst nicht zu finden sind, braucht man sich nur durch seine schwelgerischen Bilder treiben zu lassen und den Klängen seiner nostalgischen, trunken machenden Prosa zu lauschen. Und man spürt: Der Sprache dieses Romans ist ein süßes Gift beigemischt. Denn all der poetische Aufwand gilt einer durch und durch verkommenen Scheinwelt.
Nur einer ist davon ausgenommen, Gatsby selbst, ein zwielichtiger Charakter, den eine einzige Qualität rettet: Er kann noch träumen. Dass sein Bild von einer schönen Frau die Wirklichkeit verkennt, ja dass der Gegenstand von Gatsbys Anbetung unwürdig ist, tut nichts zur Sache. Fitzgerald untersucht sein Zeitalter und diagnostiziert, dass außer romantischem Sehnen nichts mehr übrig ist - kein Gott, keine Werte, kein Staat. Es gelingt ihm das Kunststück, die zerstobene Hoffnung eines Gauners in große Tragödie zu verwandeln und an der Nichtigkeit seines Traums zugleich die Größe seines Traums zu beweisen. Mehr ist aus der moralischen Konkursmasse nicht zu retten.
"Der große Gatsby" predigt oder moralisiert nicht. Im Gegenteil, seitenlang feiert er die flüchtigsten Sehnsuchtsmomente. Die Musik der Sprache ist dabei so echt, wie die geschilderten Gegenstände trügerisch sind. Dahinter steht ein künstlerisches Programm. Nicht nur, weil der jugendliche Bestsellerautor von "Diesseits vom Paradies" den Aufstieg zum hochbezahlten Starschreiber und den Sturz in Alkohol und Depression selbst erlebt hat, also jedes Wort beglaubigen kann. Sondern weil er sich als Schriftsteller immer in einer Doppelrolle sah: im Ballsaal das schönste Mädchen zu erwischen und sich zugleich draußen an der Fensterscheibe die Nase plattzudrücken. Ausgelassener Tänzer und distanzierter Beobachter, Fitzgerald war beides in einer Person.
Nie wurden Hedonismus und Langeweile schöner beschrieben als bei ihm. "Her voice is full of money." Dieser wunderbare englische Satz ist berühmt geworden. Gatsby, der damit seine frühere Freundin Daisy beschreibt, die inzwischen einem anderen gehört, deutet an, dass er die Regeln der Tauschgesellschaft begriffen hat, auch wenn ihn das nicht davor bewahrt, einer Täuschung zu erliegen. Als er für seine Angebetete in einem Anfall von Warenfetischismus seine gefalteten Hemden aus dem Schrank holt und ihr triumphierend die verschwenderisch edlen Stoffe hinwirft, schluchzt Daisy vor Glück: So schöne Hemden hat sie noch nie gesehen. Es ist die literarische Vorwegnahme des Werbefernsehens.
Keine einzige Figur des Romans, das darf nicht unerwähnt bleiben, ist "gut". Und ob der Erzähler, ein kleiner Börsenberater namens Nick Carraway, überhaupt begreift, welch ungeheuerliche Geschichte er uns da erzählt, ist fraglich. Am Ende haben wir Aufstieg und Fall eines unermesslich reichen und moralisch dubiosen Mannes erlebt, Jay Gatsby, dessen eigentliches Ziel, die Eroberung seiner Jugendliebe, an einer korrupten Welt zerbricht und uns mit einem sonderbaren Gefühl von Untröstlichkeit zurücklässt.
Fitzgerald hat für diese desillusionierte Ära Bilder gefunden, die wir noch heute als zeitgenössisch empfinden. Die frühen Kapitel beschreiben in glühenden Farben Gatsbys aufwendige Feste auf seinem Anwesen in Long Island, zu denen man einfach hingeht, ohne eingeladen zu sein, ganz wie die überlaufenen Facebook-Partys von heute, nur fünfzigmal so teuer. Doch so wie hier wurden Partys in der Literatur noch nie beschrieben: so ostentativ wie richtungslos, der vollkommene Ausdruck eines Reichs ohne Zentrum und Urheber. So sehr schnurrt in diesem Ambiente alles zu narzisstischen Gesten zusammen, dass die meisten ungeladenen Gäste wieder gehen, ohne den Gastgeber Gatsby je zu Gesicht bekommen zu haben. Sein Begräbnis bald darauf wird zur einsamsten Veranstaltung der Welt.
Das Nachleben eines Romans hängt nicht so sehr davon ab, ob seine Themen sich krampfhaft "aktualisieren" lassen oder mit dem heutigen Geschmack kompatibel sind. Es steht und fällt mit der literarischen Qualität. "Der große Gatsby" reifte zu einem Werk heran, mit dem F. Scott Fitzgerald aus dem Rollenklischee des frivolen Wunderkinds der Jazz-Ära heraustreten und sich als ernsthafter Künstler beweisen wollte. Die Absicht ist nicht nur in den Briefen an seinen Lektor Max Perkins dokumentiert, sie lässt sich aus gewissenhaften Überarbeitungen schließen. Dass wir diesen Roman noch heute lesen, beruht auf seiner Dichte, Spannung, poetischen Qualität und der reflektierten Ausgestaltung seiner Motive. Nur in dieser Form konnte der Gatsby-Stoff sein Leben bewahren und symptomatisch für seine (und unsere) Zeit werden.
Man kann das nicht deutlich genug betonen, denn neun von zehn Romanen, die im Jahre 1925 auf der amerikanischen Bestsellerliste standen, sind heute vergessen; "Der große Gatsby" nicht. Wie kein anderer amerikanischer Roman des zwanzigsten Jahrhunderts zieht er den gewöhnlichen Leser ebenso an wie Scharen von Philologen, wird unermüdlich gedeutet, zerlegt, veropert, verfilmt (demnächst mit Leonardo DiCaprio), und seit dem Jahr 2000 gibt es in der Cambridge Edition unter dem Titel "Trimalchio" sogar die unlektorierte Vorstufe des Romans zu kaufen - alles, um zu beweisen, dass für die minutiöse Untersuchung von Fitzgeralds Genie bei der Schaffung seiner mythischen Romanfigur kein Aufwand übertrieben ist.
"Der große Gatsby" ist aber auch der Roman der "Gefällt mir"-Generation, des allgegenwärtigen Geredes und der Macht des Plebiszits. Oft sind Geschichten von Aufstieg und Fall ja mit einer moralisierenden Lehre verbunden. "Die Gesellschaft" erweist sich darin als Machtfaktor, der den Einzelnen aus der Menge heraushebt und mit derselben Leichtigkeit wieder überrollt. Im "Großen Gatsby" lässt sich diese Unterscheidung nicht mehr treffen. Dem Parvenü Jay Gatsby, der sich elternlos neu erfindet, um seinem romantischen Traum nachzujagen, steht keine definierte Gesellschaft gegenüber, sondern ein materialistisches, wie rasend beschleunigtes Zeitalter, in dem jeder nach den Rettungsringen greift.
Dass der Roman wenige Jahre vor dem Schwarzen Freitag des Börsencrashs von 1929 spielt, sollte uns nicht täuschen. Das "alte Geld", das es damals noch gab, kommt im Roman kaum vor. Als hätte Fitzgerald den Aufstieg einer neuen Klasse in der Luft gewittert, bevölkert er seinen Roman mit Neureichen, Trickkünstlern und Finanzschwindlern, darunter auch ein gewisser Meyer Wolfshiem, ein unverhülltes Abbild des mutmaßlichen Wettbetrügers Arnold Rothstein. Fitzgerald selbst übrigens zerrann das Geld zwischen den Fingern, obwohl er 1929 für jede verkaufte Story Spitzenpreise von mehreren tausend Dollar kassierte. Für den "Großen Gatsby" verzeichnet das Haushaltsbuch jenes Jahres eine andere Einnahme: fünf Dollar und zehn Cent.
PAUL INGENDAAY
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main