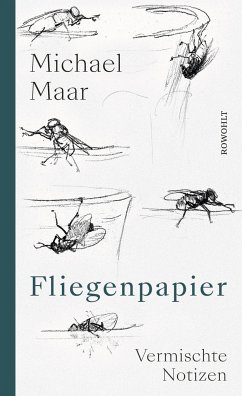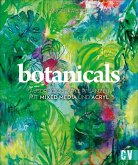«Man liebt nicht weil, man liebt obwohl.» Nach seiner bewunderten Stilstudie «Die Schlange im Wolfspelz» legt Michael Maar eine schlanke und sehr private Sammlung von Notizen, Betrachtungen, Aphorismen, Anekdoten und kurzen Prosastücken vor über all das, was ihm im Lauf der Jahre buchenswert erschien. Maar handelt von Musik und Metaphysik, von prophetischen Träumen, vom in der Luft schwebenden Glas, von den blauen Häkchen bei WhatsApp und wie sie Proust gequält haben würden; von den Frauen bei Tschechow, vom Bahnhofs-Youporn unter Lenin, von Wolfgang Paulis tödlichem Problem mit der Zahl 137, von Joseph Roths Taschenuhr, von Stifters Unfruchtbarkeit, von Fichte, der bei Goethe lässig seinen Mantel abwirft, von Doctorows «Ragtime» als Kleist-Thriller, von den Rätseln der Kosmologie; von der süßen Angewohnheit zu leben, zu lesen, zu lieben, zu altern und nachzudenken.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Wer sich mit Genuss und Gewinn auf 'Die Schlange im Wolfspelz' einließ, wird auch zu diesem neuen Büchlein greifen ... ein großer Stilist. Philipp Haibach Lesart 20230329
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Hilmar Klute empfiehlt Michael Maars Prosaminiaturen als exquisiten Happen für zwischendurch. Der Kritiker lässt sich die meisten der Sprach-, Denk- und Lesebeobachtungen, die Maar in dem schmalen Band zusammengestellt hat, munden, etwa wenn der Germanist ihm erläutert, wieviel das "Chamäleonwort Eh" im Österreichischen abzubilden vermag. Ganz hingerissen folgt Klute Maar auch, wenn dieser die "genialen Schwächen" von Weltliteraten wie Tolstoi, Tschechow oder Proust auslotet. Und so schaut der Rezensent gern über ein paar "Kiesel" zwischen den "Juwelen" hinweg.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH