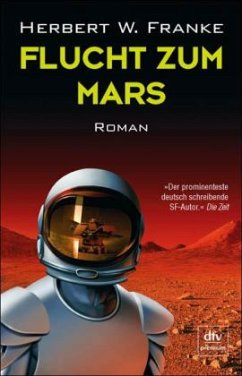Im 23. Jahrhundert fliegt eine achtköpfige Gruppe zu einem Erlebnisspiel auf den Mars. Ihre Aufgabe besteht darin, die Insignien der letzten chinesischen Kaiserdynastie zu bergen und auf die Erde zurückzubringen. Im Zuge des Ost-Westlichen Krieges hatten die Chinesen auf dem Mars eine Station eingerichtet, die »Festung«, in der sie neben dem Jadeschatz vor allem Nuklearwaffen und Militärroboter lagerten und die nach einem eventuell verlorenen Krieg als eine Art Refugium dienen sollte. Anfangs glauben die meisten Teammitglieder an eine Simulation, doch als sich herausstellt, dass sie gefahrvollen Situationen ausgesetzt werden und überhaupt kein Kontakt zur Erde besteht, wird aus dem Spiel bitterer Ernst. Als bei eine Minenexplosion das Raumschiff lahmgelegt wird und sie sich zu Fuß durchschlagen müssen, entführen Androide nach und nach sämtliche Teammitglieder, mit Ausnahme von Alf und Sylvie, denen es gelingt, in die Festung einzudringen und einen Teil ihrer Gefährten zu befreien. Doch Ramses, ihr selbsternannter Anführer, treibt ein merkwürdiges Spiel und weiß viel mehr über ihre Expedition, als er zugibt.
Die Marshöhlen, die Herbert W. Franke in diesem Roman und auch in seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen erwähnt, sind keine Fiktion. Neueste Entdeckungen der Nasa im Mai 2007 bestätigen die theoretisch fundierten Voraussagen Frankes.
Die Marshöhlen, die Herbert W. Franke in diesem Roman und auch in seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen erwähnt, sind keine Fiktion. Neueste Entdeckungen der Nasa im Mai 2007 bestätigen die theoretisch fundierten Voraussagen Frankes.

Herbert W. Frankes Sciencefiction-Roman "Flucht zum Mars"
Zum Schluss muss es weh tun, sonst bleibt die Lehre aus, die erteilt werden soll. Rundum sachgemäß wird also die ethische Differenz zwischen dem geleckten Konformisten und dem mutigen Selbsterzieher am Ende als Faustkampf ausgetragen, weil das eine immer achtenswerte Tradition der Textsorte "allegorische Zivilisationskarambolage" verlangt: "Dann ging Alf mit geballten Fäusten auf Ramses los, der hinter dem Schlitten Schutz suchte. Als er Alf auf sich zukommen sah, benutzte er das Fahrzeug zur Abwehr. Auf den suprakalten Kufen ließ es sich in jede Richtung bewegen, und die Schwungräder in der Bodenplatte hielten es aufrecht, so dass Alf nicht an Ramses herankam." Eine Schlägerei wie ein Schaltplan, in übersichtlichem Aufriss gezeichnet, dazu Requisiten aus dem Geräteschuppen ("Schwungräder", "Bodenplatte") und dem Physiklabor ("suprakalte Kufen") - Exaktheit, Konzision und Sinn für Proportionen, die hier das Sprachliche regieren, schaffen beim Lesen der Passage unmittelbar Behagen; man merkt ja immer gern, dass man einem Menschen zuhört, der weiß, wovon er redet.
"Flucht zum Mars" heißt das Buch. Der Titel, so geradeaus und nachvollziehbar es im Werk selbst sonst zugeht, ist eine arglistige Täuschung: Von "Flucht", Ausweichen oder sonst einer Absetzbewegung keine Spur - die acht Figuren, die eine sterile irdische Gesellschaft als Astronauten und Schnitzeljäger auf den Nachbarplaneten geschickt hat, damit sie dort an einem "Erlebnisspiel" mit mindestens doppeltem, eher vierfachem Boden teilnehmen, entkommen ihrem Elend keineswegs. Abgeschnitten vom Vertrauten, werden sie vielmehr erst recht auf Anlagen, Prägungen und Denkfehler zurückgeworfen, die zum Davonlaufen sind und zugleich unentrinnbar.
Das Ganze ist ein Sozialdrama um Bewährung und Ruin in Extremsituationen, dargeboten auf dem kalten Objektträger künstlich herbeigeführter Isolation - eine große und riskante Form, die dem modernen Romancier seit "Robinson Crusoe" dabei hilft, das Menschliche, das Allzumenschliche und das Unmenschliche zusammenzudenken. Wer so ein Buch schreibt, schließt mit vollem Risiko an Klassisches an. Herbert W. Franke, der Verfasser von "Flucht zum Mars", besitzt jedes Recht darauf, diesen Anschluss zu suchen - er ist neben Wolfgang Jeschke der erfahrenste und stilsicherste unter den deutschen Sciencefiction-Autoren; selbst längst ein Klassiker auf seinem Feld.
Bis dieser Status erreicht war, hat er, wie sich's gehört, viele Widerstände überwinden müssen. Dichtender Forscher durfte er nicht werden, so wurde er eben wissenschaftlicher Erzähler - es war Carl Friedrich von Weizsäcker, der ihm den Weg der ersten Wahl verstellte, als der junge Franke dem hochangesehenen Gelehrten die Skizze einer neuen Deutung der Quantenmechanik zur Veröffentlichung anbot. "Nicht besonders lehrreich" könnten solche eher philosophisch als technisch interessanten Entwürfe sein, da sie keine auffälligen Rechenwegersparnisse mit sich brächten, fand von Weizsäcker. Der abgewiesene Anfänger besaß nicht die Macht, ihm mit Aussicht auf Erfolg zu widersprechen. Abweichende Auslegungen von in ihrem Kernbestand gesicherten Datensätzen schaffen zwar nicht in der Forschung, wohl aber in der Kunst neue Werte; wenn sie neu genug sind, unter Umständen sogar bleibende.
Daran hat Franke sich nach der ersten Niederlage ausdauernd versucht. Heute nennt ihn die deutsche Presse "den prominentesten deutsch schreibenden SF-Autor", was allein zwar nicht viel sagt, sein tatsächliches Gewicht aber durch das Urteil des international angesehensten Sciencefiction-Kritikers John Clute empfängt, Franke gehöre zu den wenigen deutsch schreibenden Schriftstellern im Genre, "deren Arbeiten sich mit denen auf Englisch und in anderen europäischen Sprachen messen können". Als Weltbürger einer fürs zwanzigste Jahrhundert sehr wichtigen Sorte Weltliteratur hat Franke Anteil auch daran gehabt, dass der in Clutes Lob angestellte Vergleich für ausschließlich deutsch Lesende überhaupt nachvollziehbar ist - in seiner Anthologienreihe "Kontinuum" druckte er regelmäßig nicht nur die üblichen Amerikaner und Engländer, sondern auch Deutsche wie Michael K. Iwoleit, die Russin Olga Larionowa, Bertil Martensson aus Schweden oder diverse Italiener.
Seine eigenen Themen, Stoffe und Ausdrucksmittel fand und verfeinerte er zu Zeiten, als der Kalte Krieg noch alle Aussichten bot, bald zum heißen zu werden. Es gehört zu den subtileren Reizen von "Flucht zum Mars", dass man Zeitkolorit jener Lage darin, wenn auch zum Glück nirgends grob ideologisch, überall finden kann. Die fade Zukunft, die Franke hier malt und mit sarkastischer Grimasse "Goldenes Zeitalter" nennt, weist die ihm jeweils widerlichsten Seiten der ehemaligen Sowjetunion und der fortexistierenden Vereinigten Staaten von Amerika auf: Die Gängelung, der seine Figuren ausgesetzt sind, riecht nach Frankes Ostblockbild (es gibt schrankenlos befugte Beamte für alles, der Staat führt über jeden eine Akte); die hirnlose Unterhaltungsjauche dagegen, in der sie täglich baden müssen, schmeckt nach seiner schlechten Meinung vom kapitalistischen Westen ("Barbie Brain" heißt der Zentralcomputer; Erfrischungsgetränke gewinnt man, indem man "Cola-Pulver" aufschäumen lässt; sogar "Sciencefiction-Filme" gibt es noch, sie sind kein Lichtblick).
Aus beiden Welten hat das Trägste, Zäheste und Dämlichste überlebt, nun, da der Konflikt beendet ist. Frankes als Verlängerung alter Anamnesen ins Morgen ausgestaltete Prophetie zehrt davon, dass man in den Lehrjahren dieses Autors fand, das Beste am Systemkonflikt sei der Umstand, dass er beide Seiten dazu zwinge, darum zu wetteifern, welche von beiden fortschrittlicher sei.
Was uns in einer Handvoll Jahren von der Lochkartenrechnerzeit in die Epoche des Netzwissens getrieben hat, war tatsächlich der Vorsatz zweier Gesellschaften, die Frage zu klären, wie das Zusammenleben menschengerecht einzurichten sei. Vorbei, sagt Franke jetzt; ruhe in Frieden, menschlicher Weltenerbauerehrgeiz: "In den letzten beiden Jahrhunderten, seit dem Beginn des Goldenen Zeitalters, hatte es keine Weiterentwicklung der Raumfahrt gegeben - man hatte sie eingestellt, und Wissenschaft und Technik wurden nur noch betrieben, um die letzten für das praktische Zusammenleben der Menschen nötigen Probleme zu lösen." Ein hübscher Freudscher Vergrübler: Es gibt also "nötige Probleme".
Das merkwürdige Wort kann da stehen, weil Franke hartnäckig daran glaubt, dass Verbesserungen im Sozialen stets Kämpfe zwischen Menschen voraussetzen; es müssen ja keine brachialen, es können argumentative sein. Da dürfen ihm sogar Marxisten zustimmen, mit Verweis darauf, dass das kapitalistische Wirtschaften selten so heillos aussah wie heute, da niemand im Weltmaßstab mehr eine irdische Alternative anbietet. Seit das Konkurrenzprinzip konkurrenzlos ist, macht sich die falsche Bonhomie eines um seine moralische Begründung gebrachten Pragmatismus breit, der zwar fleißig handelt, aber nicht mehr weiß, wovon.
Diesem Zustand abzuhelfen, bedarf es der Perspektive auf seine tätige Überwindung, und die erfordert, neben anderem, auch spekulatives Erzählenkönnen. In diesem Licht verdient "Flucht zum Mars" als ernste Tragikomödie gelesen zu werden. Acht Menschen führt Franke, scheinbar als Kandidaten einer Reality-Show, in Wahrheit aber mit einem ihnen anfangs selbst weitgehend unbekannten und hochgefährlichen Schatzsucherauftrag, an ihre Grenzen und zwingt einige davon über diese hinaus. Die Fäden zieht durchweg ein kluger Mann, kein lieber. Die Handvoll zwischen das große Abenteuer eingeschobener Miniaturen, in denen er das individuelle Herkommen der acht Akteure erläutert, sind hochauflösende charakterologische Kirlianfotos, die allein schon den Preis fürs Buch lohnen.
Henrich zum Beispiel wird Rebell, weil ihm "für Fragen oder Proteste keine Gelegenheit" gegeben wurde; der kräftige Cassius steht unter Beobachtung, weil man ihm "mehrfache Beteiligung an verbotenen Sportarten unter Inkaufnahme von Verletzungen seiner Gegner" nachweisen konnte; der Spaßmacher Gilbert erkennt, als man ihn zur Anpassung an den Status quo zwingt: "Die Zeit der Scherze war wohl fürs Erste vorbei"; und Alf, unverkennbar das Lieblingskind seines Erfinders, ist ein Philosoph, das heißt, er "neigt zu sinnlosen Grübeleien". So zurückhaltend, in bewusst beißend lieblosem Behördendeutsch, kann man Helden zeichnen.
"Flucht zum Mars" zieht keine Summe des Frankeschen Schaffens, sondern ist einfach das jüngste einer langen Reihe von Protokollen untereinander vielfältig verbundener Gedankenexperimente. Natürlich kommt dem Autor dabei früher Gelerntes zugute: Die weit geöffnete metaphorische Sichtblende seiner Marslandschaftsschilderungen erinnert an die Optik seiner Untersuchungen zur Phantastik in der bildenden Kunst, die er in den achtziger Jahren anlässlich der Arbeit von Leuten wie H.R. Giger oder Oscar Asboth angestellt hat; die von unsicheren Schritten widerhallenden Irrgänge durch Höhlensysteme verraten den Speleologen. Mit leichter Hand im Text verstreute Ideen zu Fragen der Simulationstheorie und Computerverlässlichkeit stammen eindeutig vom Verfasser der großen Abhandlung über "Das P-Prinzip: Naturgesetze im rechnenden Raum" (1995), und die Lakonie, mit der Beklemmungszustände und verborgene Sehnsüchte intermittierend in flüchtige Traumbilder eingekapselt werden, erinnert an den Meister der knappen Form, der schon 1964 im Bändchen "Der grüne Komet" gut drei Dutzend Kürzesterzählungen zum plausiblen Gesamtbild einer möglichen Menschenzukunft zusammenfügte.
Das Werk wächst weiter; jedes Schlusswort über seinen Schöpfer, der an diesem Montag achtzig Jahre alt wird, wäre verfrüht.
DIETMAR DATH
Herbert W. Franke: "Flucht zum Mars". Roman. Verlag dtv premium, München 2007. 349 S., br., 14,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kein Schlusswort, aber krönend dann doch, was Dietmar Dath da über den achtzigjährigen SF-Autor Herbert W. Franke schreibt. Für alle, die ihn nicht kennen, gibt Dath eine Kurzvita des Mannes dazu, der hier laut Dath so exakt und konzis wie spekulativ ein Sozialdrama auf dem Mars in Szene setzt, dass dem Leser daraus "unmittelbar Behagen" erwächst. Allerdings verschweigt Dath die Kälte nicht, mit der Franke Menschliches seziert, und nicht das Risiko beim Hantieren mit dem riesigen Prospekt "künstlich herbeigeführter Isolation". Als Klassiker komme Franke damit schon klar. Zu den subtileren Reizen des Buches gehören für den Rezensenten unter anderem auch ein an den Kalten Krieg gemahnendes Zeitkolorit, eine möglichst zurückhaltende, dabei treffende Figurenzeichnung und wie beiläufig in den Text eingegangene Ideen zur Simulationstheorie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH