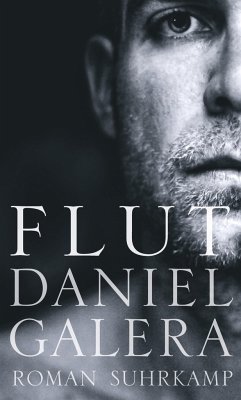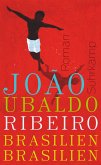Sein Vater erschießt sich, und ihm bleiben nur die alte Hündin Beta und eine innere Unruhe. Er bricht auf in den Süden und lässt sich in einem kleinen Küstenort nieder, wo er als Sportlehrer arbeitet, stundenlang im Meer schwimmt und sich verliebt. Das behagliche neue Leben ist schlagartig zu Ende, als er beginnt, ein Familiengeheimnis zu ergründen: Sein Großvater, dem er zum Verwechseln ähnlich sieht, hatte in der Gegend gelebt, bis er unter ungeklärten Umständen verschwand. Mit seiner Suche zieht er das Misstrauen der Bewohner auf sich, ungewöhnliche Dinge geschehen. Obendrein wird ihm seine Krankheit zum Verhängnis, er kann Gesichter nicht wiedererkennen. Allmählich begreift er, dass ihm das Schicksal seines Großvaters droht, doch da steht ihm das Wasser schon bis zum Hals ... Mit lichter, hypnotisierender Kraft und einer feinsinnigen Spannung erzählt »Flut« von einer Suche über drei Generationen, die an die Grenzen des Menschenmöglichen führt.
»Der spannendste Roman, den der Brasilienschwerpunkt der Buchmesse zu den deutschen Lesern gebracht hat.« Jens Jessen DIE ZEIT 20131205
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ein Versprechen auf mehr von diesem Autor ist dieser Roman von Daniel Galera für Eberhard Geisler. Warum? Weil der Autor scheinbar sehr lässig die Theologie in die leicht erzählte Geschichte eines Mannes auf der Suche nach seiner Herkunft und nach dem einfachen Leben einwebt. Die Tatsache, dass der Mann sich keine Gesichter merken kann und der Roman mit Spiegelbildern spielt, deutet Geisler, nachdem ihn der Autor immer wieder mit scheinbar bedeutungslosen Zeichen erfreut hat, als Teil einer theologischen Spekulation, derzufolge der Mensch erst frei ist, wenn er Gottes Antlitz als Verlöschendes begreift (oder so ähnlich). Für Geisler eine faszinierende Sache - der Gedanke wie auch die Niederlegung im Roman.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Lord Chandos am Strand: In seinem Roman "Flut" erzählt der brasilianische Autor Daniel Galera die Geschichte eines Mannes, dem Gesichter und Worte entgleiten.
Ein junger Mann stellt anhand eines Fotos fest, dass er seinem in einem fernen Dorf verschollenen, totgeglaubten Großvater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, und macht sich auf die Suche nach Spuren von ihm. Er nimmt das betreffende Foto, schnipselt es auf Passgröße zurecht und steckt es in die Plastikhülle seiner Brieftasche, wo früher sein eigenes Foto gesteckt hat. Derart ausgestattet, macht er sich auf den Weg zu dem kleinen Ort an der Küste, wo der Großvater zuletzt gesichtet worden sein soll. So beginnt die Geschichte. Sie enthält einiges an Sprengstoff.
Der Protagonist, dessen Namen wir nicht erfahren, besucht eingangs seinen Vater in Porto Alegre. Hier kommt bereits die Rede auf den geheimnisumwitterten Großvater, der eines Tages die Familie verließ, durch Südamerika zog, in Garopaba, einem kleinen Ort an der brasilianischen Küste, sich niederließ, Hühner hielt, Palmenblätter sammelte, sich vor allem als guter Schwimmer erwies und am Ende bei einer wilden Messerstecherei ums Leben gekommen sein soll. Der Vater kündigt sodann seinen Selbstmord aus Lebensmüdigkeit an und bittet seinen Sohn, sich später um seine Hündin zu kümmern. Der namenlose Romanheld begibt sich nach vollzogenem Selbstmord des Vaters in besagtes Garopaba, um ein einfaches Leben zu führen, eine Frau zu vergessen, das Meer zu genießen, ausgiebig zu schwimmen, Schwimmunterricht zu geben, durch den Ort zu schlendern, einzelnen Anwohnern im Vorübergehen zuzunicken, Cheeseburger zu essen und Bier zu trinken.
Was er sucht, ist die Leere: "Hinter dem Morro da Vigia, gesprenkelt mit den Lichtern von Häusern und Straßenlaternen, liegt die Leere, deretwegen er hergekommen ist." Zentral für das Verständnis des Buches ist der Umstand, dass die Hauptfigur seit ihrer Kindheit unter einem pathologischen Vergessen von Gesichtern leidet, was jetzt bei Frauenbegegnungen zum Problem wird: Er sieht schöne Mädchen, erkennt sie beim nächsten Mal aber nicht wieder. Er orientiert sich darum an Stimmen, Kleidern und Gesten. Bei allem betreibt er immer auch die Suche nach seinem Großvater, sammelt Spuren und wird von einem Fremden, der den Alten noch gekannt hat, auf der Straße wegen der verblüffenden Ähnlichkeit sogar einmal als dessen Enkel identifiziert. Galera betreibt ein Spiel der Spiegelung wie der Negation des Spiegelbilds. Dieses stellt sich ein, muss aber im selben Moment zerbrochen werden. Einmal springt der Protagonist von einem Felsen ins Meer wie in sein eigenes Spiegelbild, heißt es, aber die Wellen breiten sich kreisförmig aus: Keinerlei Fixierung ist möglich.
Die Lust am Selbstverlust wird hier aber zu einem Gewinn. In der Liebe erkennt unser Mann, dass er sich das Gesicht der Geliebten zwar nicht merken, sich an ihrem Körper aber vielfach berauschen kann. "Ein weiteres Mal staunt er, auf welch unterschiedliche Art und Weise die Welt sich seinen Sinnen offenbaren kann. Nichts geht verloren, außer den Gesichtern." Einmal trifft der Mann auf eine Gruppe von Mädchen und schaut ihnen beim Abschied in die Augen. Diese Augen zeichnen sich durch Transparenz aus; sie ermöglichen ein Schauen, das auf nichts geheftet ist. "Von seinem Platz aus sieht er, wie sich die Sonne in ihren großen Augen spiegelt, sie sind grün und durchsichtig wie das Wasser an diesem Tag. Er kann sie gut sehen, obwohl sie nicht in seine Richtung blicken, so wie Pferde oder Vögel, die uns beobachten, ohne den Blick auf uns zu richten." Sich mit Ausdauer einen Weg durch die Wellen bahnend, fühlt sich der Mann gleichsam vom Meer befragt, ob er nicht irgendetwas Wichtiges vergessen habe.
Konsequent verweist der Autor immer wieder auf Zeichen und Signale, die keinerlei Bedeutung mit sich führen. Die Meeresbrandung rauscht, Autos hupen, Motoren knattern, Grillen zirpen. Einmal ist die Rede von Fischern am Strand, die Netze einholen und dabei lauthals schreien, ohne jedoch vom Beobachter verstanden werden zu können, weil ihre Rufe im Tosen der Wellen untergehen. Ein anderes Mal fällt dem Mann etwas auf, als er sich selber sprechen hört: "In Gedanken hört er ganz deutlich, was er sagen will, aber in dem Augenblick, in dem die Worte aus seinem Mund kommen, lösen sie sich auf." Lord Chandos am Strand.
Die Besessenheit, mit der hier von Ebenbildlichkeit und dem permanenten Vergessen der Gesichter die Rede ist, drängt dem Leser eine brisante theologische Spekulation auf. In diesem Buch, in dem geschwommen, gejoggt, geliebt, manches ziellose Gespräch geführt und nachts am Strand mit Zufallsbekanntschaften Party gefeiert wird, liegt auf den ersten Blick nichts ferner als Theologie. Und doch scheint gerade die Leichtigkeit der Sprache, der wir hier begegnen, mit dem Thema des Gesichts und damit einer bemerkenswerten theologischen Position zu tun zu haben. Das Buch scheint die Einsicht vermitteln zu wollen, dass der Erzähler in dem Augenblick, in dem er das Antlitz des Gottes selbst, auf das die abendländische Tradition stets als auf ihr Höchstes fixiert war, als ein Verlöschendes begreift, gerade dadurch beginnen kann, dem anfänglichen Wort recht zu entsprechen, es weiterzusprechen.
Faszinierend ist, wie im Augenblick der Entleerung der Zeichen und der Einsicht, dass Identität nicht durch Spiegelung zu erreichen ist, ein Schreiben möglich wird, in dem sich die Wirklichkeit wie von selber zeichnet. Die abendliche Farbe des Meeres, das Gelächter des alten Mannes, das sich mit dem Rauschen der Brandung mischt, die jungen Frauen am Kiosk, die plaudern und ein Dosenbier miteinander trinken. In "Flut" entdeckt ein Dreiunddreißigjähriger das Geheimnis des Erzählens für sich. Daniel Galera behandelt es in seinem Roman auf eine Weise, die noch einiges von diesem jungen Talent erwarten lässt.
EBERHARD GEISLER
Daniel Galera: "Flut". Roman.
Aus dem Brasilianischen von Nicolai von Schweder-Schreiner. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 423 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"... wie von einer geheimen Kraftquelle gespeist."
Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 07.07.2013
Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 07.07.2013