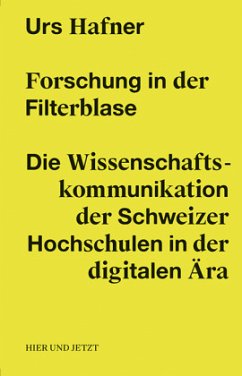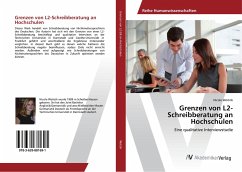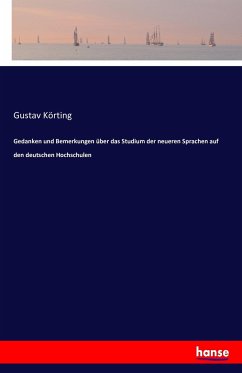Die Schweizer Hochschulen bauten in den letzten Jahren ihre Kommunikationsstellen massiv aus, insbesondere im Bereich Social Media. Sie erhoffen sich davon die zielgenaue Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger sollen besser über die Leistungen der von ihnen finanzierten Forschung informiert werden. Denn unbestritten gilt: In der demokratischen Wissensgesellschaft muss zwischen Forschung und Publikum ein offener Dialog geführt werden, in beiderseitigem Interesse. Doch die Kommunikationsstellen wenden sich von der breiten Öffentlichkeit ab. Sie betreiben primär Reputationsmanagement und Community-Building der aktuellen und künftigen Studierenden, also ihrer "Kunden". Sie kommunizieren wie Unternehmen und vernachlässigen den Diskurs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und die Medien übernehmen die professionell aufbereiteten Erfolgsmeldungen dankbar. Wer springt in die Bresche?
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Das Wissen, das die Wissenschaft erzeugt, ist komplex und nicht immer leicht vermittelbar, weiß Rezensent Thomas Ribi, dennoch hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, denn schließlich ist es ja ihr Wissen, weil mit ihren Geldern finanziert. Wenn nun der Historiker Urs Hafner die Kommunikation kritisiert, die Schweizer Hochschulen betreiben, treffe er einen wichtigen Punkt, findet Ribi: Denn statt Inhalte zu vermitteln, betrieben die Pressestellen der Universitäten in erster Linie Imagepflege. Ribi kann dem nur zustimmen, ebenso der Feststellung, dass Medien daran nicht ganz schuldlos seien, wenn sie ihre Wissenschaftsredaktionen immer schlechter austatteten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH