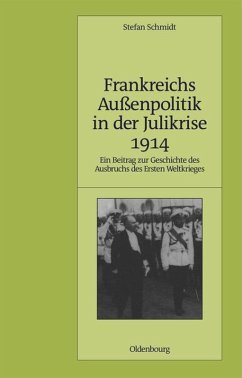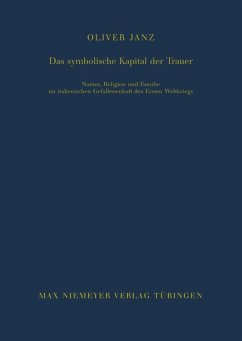Auch wenn die Genese des Ersten Weltkriegs - der "Ur-Katastrophe" des 20. Jahrhunderts - als gründlich erforscht gilt, verzeichnet die Geschichte des Kriegsausbruchs immer noch Bereiche, deren Bearbeitung bislang vernachlässigt wurde. Zu ihnen gehört die französische Außenpolitik in der Julikrise 1914. Obwohl in der wissenschaftlichen Kontroverse der Zwischenkriegszeit kein Konsens über Motive und Absichten des "forgotten belligerent of July 1914" (John W. Langdon) gefunden werden konnte, sind dem Gegenstand nach 1945 nur wenige Untersuchungen gewidmet. In dieses bislang kaum beachtete Terrain stößt die Studie vor. Nicht zuletzt auf der Grundlage neuer Quellen entwirft sie im Gegensatz zur älteren Forschung von Frankreich das Bild einer Großmacht, die im Juli 1914 einen äußerst riskanten und den Krieg bereitwillig in Kauf nehmenden außenpolitischen Kurs der machtpolitischen Pression und militärischen Demonstration steuerte, um ihren Rang im internationalen Staatensystem zu behaupten.
Stefan Schmidt, geboren 1974, ist im Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages tätig.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Stefan Schmidt, geboren 1974, ist im Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages tätig.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Frankreich ordnete sich in der Julikrise 1914 Russland bedingungslos unter
Als die Fischer-Kontroverse in den sechziger Jahren über die deutschen Kriegsziele tobte, war im Westen alles ruhig; als die bohrenden Fragen immer mehr auf die Julikrise 1914 zielten, fand sich in Frankreich erst recht niemand angesprochen. Die Erklärung für die Zurückhaltung ist einfach. Die Franzosen - in dieser Frage von links bis rechts einmal einig - waren überzeugt, Opfer eines deutschen Angriffs geworden zu sein. Denn Frankreich hatte seine Truppen von der Grenze zurückgezogen, aber am 3. August 1914 erfolgte die deutsche Kriegserklärung mit einer den Tatsachen hohnsprechenden Begründung. Die Schuldfrage war damit beantwortet. Dass diese Sicht der Dinge so lange Bestand hatte, ist vor allem auf den französischen Historiker Pierre Renouvin zurückzuführen. Er war die zentrale Gestalt der französischen Zeitgeschichtsforschung und hatte schon früh die These vertreten, dass Frankreich einen "defensiven Kurs" gesteuert, diesen aber nicht habe durchhalten können, als Russland am 30. Juli 1914 die Generalmobilmachung verkündete. Aber auch dann habe für Frankreich nicht die "Treue zum russischen Bündnis", sondern das "europäische Gleichgewicht" im Vordergrund gestanden. Dieses sei aber die "wesentliche Bedingung seiner eigenen Sicherheit" gewesen. So hätten dann die Dinge ihren Lauf genommen.
Die Frage der Kriegsschuld ist heute kein Thema mehr. Aber die umfassende Klärung des historischen Sachverhaltes steht noch aus. Hier setzt Stefan Schmidt an. Mit sensationellen Quellenfunden kann er nicht aufwarten, aber er bietet eine dichte, quellengesättigte Darstellung der französischen Politik in der Julikrise, die das tradierte Bild erheblich verändert. Frankreich war damals keineswegs - wie jüngere Arbeiten nahelegen - ein "minor player". Das ist eine gewaltige Unterschätzung. Denn seine effektive Diplomatie, die überraschend viele Journalisten in ihren Reihen zählte, sorgte dafür, dass die geschlossenen Verträge nicht toter Buchstabe blieben. Die beherrschende Figur am Quai d'Orsay war Raymond Poincaré. Er war bis zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten 1913 Ministerpräsident und Außenminister, der die französische Bündnispolitik während der Balkankriege intensiviert hatte und auch als Präsident der Republik weiterhin einen bestimmenden Einfluss ausübte.
Die Geheimabkommen, die die Republik 1892/94 mit dem Zarenreich geschlossen hatte, waren von ausschlaggebender Bedeutung. Frankreich konnte sich allein gegenüber Deutschland militärisch nicht behaupten. Das russische Bündnis war eine Notwendigkeit, aber es bedurfte ständiger diplomatischer und militärischer Bemühungen, um die russische Seite auf die französischen Zielsetzungen festzulegen. Denn für die Russen stand als Hauptgegner die Doppelmonarchie fest, während sie sich wenig von einem Krieg gegen Deutschland versprachen. Für sie kam bestenfalls eine begrenzte Aktion gegen Ostpreußen in Frage. Das war für die französische Seite inakzeptabel. Der Schlieffen-Plan war im "Grundriss" bekannt; der Generalstab wusste, dass das Gros der deutschen Truppen gegen Frankreich antreten würde. Umso wichtiger war es, dass der russische Bündnispartner möglichst viele deutsche Truppen band und so die französische Front entlastete.
Vom 20. bis 23. Juli 1914 absolvierte der Präsident der Republik einen Staatsbesuch in St. Petersburg - also unmittelbar vor dem Bekanntwerden des Ultimatums an Serbien, das die Gefahr eines allgemeinen Krieges offenbar werden ließ. Was für Erklärungen hat Poincaré in dieser Situation abgegeben? Im französischen Aktenwerk ist über den Besuch nichts enthalten, was die Herausgeber veranlasst hat, von einer "Anomalie" zu sprechen. Bereits früh habe Poincaré mit der Wahrscheinlichkeit eines allgemeinen Krieges gerechnet. Aus einer Reihe von Indizien glaubt Schmidt den Schluss ziehen zu können, dass der Präsident eine "Zusicherung unbegrenzten Beistandes" gegeben hat. Sein Abschiedstoast habe seinen Standpunkt deutlich gemacht, als Poincaré von einem für beide Mächte verbindlichen "Frieden der Stärke, der Ehre und der Würde" gesprochen habe. Aber vor dem Hintergrund der intensiven Kriegsvorbereitungen in den Jahren zuvor erhalten die Gesten des Petersburger Besuches ihr eigentliches Gesicht. Denn sie bestätigen nur die Politik, die in den Jahren zuvor planmäßig entwickelt wurde.
Frankreich ordnete sich Russland in der Frage Krieg oder Frieden bedingungslos unter. Es konnte nur seine Hilfe zusichern, durfte aber selbst nicht aktiv in Erscheinung treten, war doch die Bevölkerung für einen Krieg im Osten nicht zu haben. Deshalb war die französische Diplomatie unablässig und mit Erfolg bemüht, "Frankreich in eine möglichst günstige Ausgangsposition für den Krieg zu manövrieren". Dazu gehörte vor allem, "das Deutsche Reich mit dem Odium des Aggressors zu belasten". Die Regie klappte: "Noch nie", so vertraute Poincaré am 3. August 1914 seinem Tagebuch an, "ist eine Kriegserklärung mit solcher Genugtuung entgegengenommen worden." Denn sie passte genau in das Konzept. Die Julikrise gilt als das am besten dokumentierte und erforschte Kapitel der Weltgeschichte. Die Arbeit von Schmidt hat deutlich gemacht, dass es noch Lücken gibt. Er hat eine geschlossen.
HENNING KÖHLER.
Stefan Schmidt: Frankreichs Außenpolitik in der Julikrise 1914. Ein Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. R. Oldenbourg Verlag, München 2009. 440 S., 49,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Obgleich die Julikrise zu den am besten dokumentierten und erforschten Kapiteln der Weltgeschichte gehört, wie Henning Köhler weiß, konnte ihm die vorliegende Arbeit von Stefan Schmidt zeigen, dass es noch Lücken gibt. Der Autor, so Köhler, warte zwar nicht mit sensationellen Quellenfunden auf, biete aber eine dichte, quellensatte Darstellung der französischen Politik in der Julikrise. Schmidts Indizienreihe, die zeigt, dass Frankreich mit Raymond Poincare als maßgeblicher Akteur damals keinesfalls eine zu vernachlässigende Rolle spielte, so versichert uns der Rezensent, hat das Zeug dazu, das tradierte Bild "erheblich" zu verändern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die Julikrise gilt als das am besten dokumentierte und erforschte Kapitel der Weltgeschichte. Die Arbeit von Schmidt hat deutlich gemacht, dass es noch Lücken gibt. Er hat eine geschlossen." Henning Köhler, FAZ 01.02.2010 "Schmidts instruktives Buch ist ein gewichtiger Beitrag zu einer angemessenen Sicht der Dinge." Hans Fenske, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 119 (2010) "Stefan Schmidts Werk ist ein gelungener und lesenswerter Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges - nicht zuletzt, weil er so viel mehr bietet, als er im Titel verspricht!" Günter Rutke, sehepunkte