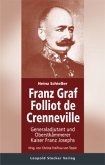Franz Joseph I., ein Kaiser, der nicht bloß über ein Reich herrschte, das einen "Anachronismus" darstellte, sondern der auch längst jeden Kontakt mit einer sich rapide verändernden Welt verloren hatte? Dieses Buch zeichnet ein ganz anderes Bild und unternimmt eine Neubewertung der Epoche und der Person Franz Josephs, der sich zu einem der bestunterrichteten Politiker seiner Zeit entwickelte und nach der Krise der 1860er-Jahre Schritt um Schritt seine innenpolitische Handlungsfreiheit zurückgewann. Er verstand es, die Habsburgermonarchie in einem Zustand wohltemperierter Unzufriedenheit zu belassen, die kein gemeinsames Agieren der liberalen Kräfte ermöglichte, aber auch nicht den Bestand übergreifender Institutionen gefährdete. Diese Balance, die ständig nachjustiert werden musste, war das Geheimnis der Regierungskunst Kaiser Franz Josephs I.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Franz Joseph I. und die Gewaltenteilung im Vielvölkerstaat
Franz Joseph I. war von 1848 bis zu seinem Tod 1916 Kaiser von Österreich und seit 1867 König von Ungarn. Eine Regierungszeit von fast sieben Jahrzehnten auf 150 Seiten zu komprimieren ist ein schwieriges Unterfangen, das Lothar Höbelt meistert, indem er sich auf die Herrschaftstechnik im Vielvölkerstaat konzentriert. Österreich habe sich 1859 gegen Piemont-Sardinien und Frankreich in Solferino "unter seinem Wert" geschlagen; die Niederlage sei so bitter gewesen, "weil Franz Joseph persönlich den Oberbefehl übernommen hatte". 1866 habe Österreich die Unterstützung aller größeren deutschen Bundesstaaten erhalten: "Es war ein deutscher Bundeskrieg gegen Preußen . . . Im Vergleich zum Siebenjährigen Krieg handelte es sich um einen ,Krieg der sieben Wochen'. Die Cholera forderte immer noch mehr Opfer als das Zündnadelgewehr bei Königgrätz." Die Folgen dieses preußischen Sieges "bestanden im Verlust Venetiens in Italien und im Ausschluss Österreichs aus Deutschland, der allen Anschlussdebatten des 20. Jahrhunderts notwendig voranging."
Pointiert schildert Höbelt den innenpolitischen Ausgleich von 1867 als Sieg des Dualismus in zweierlei Hinsicht: zwischen monarchischer Gewalt und Volkssouveränität und zwischen Ungarn und dem "Rest". Es gab ein terminologisches Problem. Offiziell sprach man von der "Österreichisch-ungarischen Monarchie", doch erst 1915 bezeichnete man die nichtungarischen Teile als Österreich. "Bis dahin behalf man sich im bürokratischen Jargon mit den neutralen Ausdrücken ,Cisleithanien' und ,Transleithanien', um allen staatsrechtlichen Festlegungen auszuweichen." Die österreichische Hälfte hieß "die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder". 1889 "folgten die berühmten Abkürzungen: kaiserlich und königlich (,k. u. k.') für gemeinsame, ,k. k.' für cis- sowie ,k.' für transleithanische Ämter und Behörden".
Kulturkampf und Nationalitätenkonflikt, Politik und Ökonomie, "Konkordanzdemokratie und autoritäres Regiment" sowie Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg werden in Kapiteln behandelt. Der Leser erfährt von der "Trinkgeldobstruktion" des Thronfolgers, um unliebsamen Beschlüssen im Parlament einen Riegel vorzuschieben, vom Gegensatz zwischen Schönbrunn (Kaiser) und Belvedere (Thronfolger), weil Franz Ferdinand seit 1906 als Generalinspekteur der bewaffneten Macht verstärkt in die Innenpolitik eingriff. Überhaupt verkörperte die Armee die Gemeinsamkeit von Cis- und Transleithanien. Natürlich gab es Sprachenprobleme; gefordert wurde als Gegenleistung für die Erhöhung des Rekrutenkontingents sogar die teilweise Einführung des Ungarischen als Kommandosprache: "eine symbolische Konzession, denn die Kommandosprache umfasste nur rund achtzig Befehle; im Übrigen waren die Offiziere angehalten, sich zumindest rudimentäre Kenntnisse ihrer Regimentssprache anzueignen".
Im Jahr 1913 habe sich Außenminister Berchtold zu zwei Ultimaten - gegen Montenegro und gegen Serbien - hinreißen lassen und durchsetzen können, wenn auch immense "Zuschauerkosten" entstanden seien. Ende 1913 sei dann zwischen Franz Joseph und den Diplomaten - ohne die Militärs - die bewusste Entscheidung gefallen, "bei der nächsten Gelegenheit keine Ausflüchte mehr zu akzeptieren, sondern den Gordischen Knoten mit dem Schwert zu durchschlagen". Die Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo am 28. Juni 1914 sei der "ideale Vorwand für den 3. Balkankrieg" gewesen, obwohl konkrete Verantwortlichkeiten für das Attentat damals schwer belegbar waren. Berchtold schrieb später, es glaube doch niemand, dass man wegen des Thronfolgers den Krieg begonnen habe. Laut Höbelt war aber politisch bedeutsam, dass Franz Ferdinand durch seinen Tod als Gegengewicht zu den "Falken" im Wiener Außenamt ausfiel. Bei der Mission des Grafen Hoyos nach Berlin, die den Weg ebnete zum österreichisch-ungarischen Ultimatum an Serbien, habe es sich nur um eine rhetorische Frage an den Zweibund-Partner gehandelt: "Mit einer ablehnenden Haltung rechnete niemand."
Die Habsburgermonarchie - von ihren Gegnern gern als "Völkerkerker" tituliert - habe in ihren beiden letzten Jahrzehnten auf einer "gar nicht so schlecht funktionierenden Gewaltenteilung" zwischen ihrer autoritären bürokratischen Struktur, "den demokratischen, aber antiliberalen Massenbewegungen (wie sie das Abgeordnetenhaus dominierten) und den anti-demokratischen, weil elitären Liberalen (die meist weiterhin die Rathäuser beherrschten)" beruht. Diese Gewaltenteilung, so resümiert Höbelt, "artete zuweilen in Blockade aus. Doch darunter litt in erster Linie nicht der Steuerzahler, sondern die Armee - das war mit eine Garantie, dass der Ausnahmecharakter des Ausnahmezustandes gewahrt blieb."
RAINER BLASIUS
Lothar Höbelt: Franz Joseph I. Der Kaiser und sein Reich. Eine politische Geschichte. Böhlau Verlag, Wien 2009. 171 S., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Die Schwierigkeit, fast sieben Jahrzehnte Herrschaft auf rund 150 Seiten zu bringen, ist Rainer Blasius wohl bewusst. Lothar Höbelt, erklärt er uns anerkennend, gelingt es in seinem Buch über Franz Joseph I. Dass sich der Autor zu diesem Zweck auf die Herrschaftstechnik im Vielvölkerstaat konzentriert und seiner Studie Kapitel über den Kulturkampf und den Nationalitätenkonflikt oder die Rolle Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg einfügt, geht für ihn in Ordnung. Schlussendlich bekommt der Leser "pointiert" Geschildertes über die "Trinkgeldobstruktion" des Thronfolgers oder den innenpolitischen Ausgleich von 1867.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH