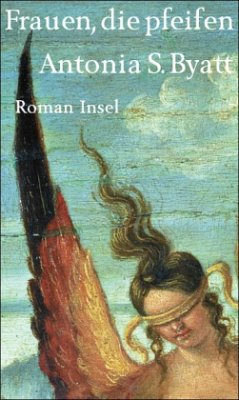Swinging London, 1968. Frederica Potter wirft ihren Job an der Kunsthochschule hin und macht, fast durch Zufall, Karriere als Moderatorin beim Fernsehen. Die Beziehung zu ihrem Geliebten John geht in die Brüche. Krisen auch in ihrem Bekanntenkreis: die Verhaltensforscherin Jacqueline, ihr Kollege Luk, Marcus, Fredericas eigenwilliger Bruder alle sind sie auf der Suche nach dem richtigen Mann, der richtigen Frau, nach Sex, nach intellektueller Herausforderung und spiritueller Einsicht. In Fredericas Heimat Yorkshire treibt derweil der Zeitgeist seltsame Blüten. Eine Anti-Universität wirrer Protestler stellt sich gegen die etablierten Wissenschaften. Auf einer Farm zieht eine Kommune mit einem charismatischen Führer ein, abgeschottet vom Rest der Welt. Die Ereignisse überstürzen sich, ein Brand bricht aus, Menschen kommen ums Leben. Würde es einen neuen Anfang geben können?
Es sind nicht nur die vielfältigen Schicksale ihrer Figuren, durch die Antonia S. Byatt ihre Leser fesselt. Körper und Geist, Kunst und Wissenschaft, Psychoanalyse und Religion nichts Geringeres als die großen Fragen der westlichen Zivilisation verbindet sie in einem kunstvollen Spiel mit Genres und Motiven zu einem komplexen, schier unerschöpflichen Romankosmos.
Es sind nicht nur die vielfältigen Schicksale ihrer Figuren, durch die Antonia S. Byatt ihre Leser fesselt. Körper und Geist, Kunst und Wissenschaft, Psychoanalyse und Religion nichts Geringeres als die großen Fragen der westlichen Zivilisation verbindet sie in einem kunstvollen Spiel mit Genres und Motiven zu einem komplexen, schier unerschöpflichen Romankosmos.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensentin Alexandra Kedves feiert die gerade siebzig Jahre alt gewordene Autorin als postmoderne Königin viktorianischer Erzählvirtuosität. Dass Antonia S. Byatt in ihrer Prosa wie niemand sonst "sense and sensibility", "tiefgründige Romanzen samt Dickens'scher Wendungen" und "Eliot'sche Ethik" zu verbinden versteht, zeigt Kedves auch dieser 2002 im Original erschienene Roman. In diesem Buch, das Kedves zufolge der Abschluss eines aus insgesamt vier Romanen bestehenden "Großbritannien-Panoramas" der Jahre 1957-1970 ist, geht es um eine alleinerziehende Mutter, die Karriere beim gerade zu seiner Form findenden Fernsehen Karriere zu machen versucht. Auch diesmal beweist sich Byatt der Rezensentin als ausgreifende, aber sichere Erzählerin. Nur ganz selten sieht Kedves die autobiografisch grundierte Handlung in einem gewissen "Pointillismus" verschwimmen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH