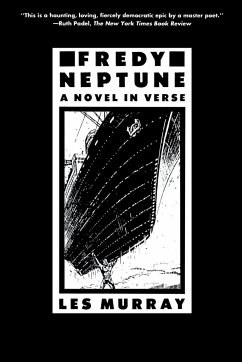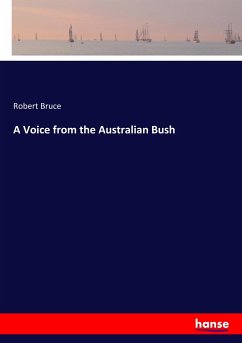Friedrich Boettcher, alias Fredy Neptune, der australische Seemann aus einer deutschen Immigrantenfamilie, wird während des Ersten Weltkriegs Zeuge der türkischen Greueltaten gegen die Armenier. Als er sieht, wie eine Gruppe von Frauen bei lebendigem Leib verbrannt wird, ist das der Schock seines Lebens. Er merkt, daß er von nun an keine Empfindungen mehr wahrnimmt, allerdings fortan zu immensen Kraftleistungen im Stande ist. Fredy versucht, nach Australien zurückzukehren,doch seine deutsche Herkunft wird ihm zur Last gelegt, womit kaum mehr ein Ort existiert, wohin er heimkehren könnte. Und so wird Fredy ins kalte Wasser der Geschichte geworfen und kämpft darum, den Kopf oben zu behalten. Die Umstände führen ihn nach Amerika, wo er sich als Hobo durchschlägt und in Hollywood kleine Filmrollen übernimmt, und nach Deutschland. Er verkehrt in den verschiedensten Kreisen, ist gleichwohl mit Pennern wie mit der Elite zu sehen, wird als deutscher Held bejubelt, um dann wieder in Vergessenheit zu geraten. Als Zeuge des Entsetzens der beiden Weltkriege im 20.Jahrhundert, versucht Fredy (erfolglos) sich zurückzuziehen, um ein möglichst einfaches Leben zu führen. Doch erst am Ende ist es ihm vergönnt, sein menschliches Empfindungsvermögen zurückzugewinnen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wahr wie die wahnsinnige Wirklichkeit: In seinem kühnen Gedichtepos "Fredy Neptune" feiert Les Murray das Mysterium der Inkarnation / Von Thomas Poiss
Wie weiterleben, wenn man 1915 mit ansehen mußte, daß im türkischen Trabzon armenische Frauen von einem ausgelassenen Mob bei lebendigem Leibe verbrannt werden? Diese Frage stellt sich Friedrich Adolph Böttcher, Sohn deutsch-australischer Kleinbauern, den das Kastrieren der Nutztiere so sehr ekelte, daß er Seemann wurde. Im August 1914 geriet er als Matrose an Bord eines deutschen Schiffes und wird so durch Zufall Augenzeuge, als die Hölle auf Erden beginnt. Er erkrankt darauf an Lepra; mit dem faulen Fleisch verliert er auch das physische Empfinden für Schmerz und Lust. Fred kämpft gegen den Schmerz der Schmerzlosigkeit. Dieser Makel verleiht ihm auch jene übermenschlichen Kräfte, die ihm später beim Zirkus den Künstlernamen Fredy Neptune eintragen: der Seemann, der nicht untergeht.
Was klingt wie die Legende eines Comichelden, erweist sich als genialer Kunstgriff. Die Fülle der erzählten Ereignisse, Lebensläufe und Todesarten wird fokussiert im Körperbewußtsein dessen, der die Wirklichkeit jenseits von Gleichgültigkeit und Stumpfsinn spüren will, ohne darüber verrückt zu werden. Um welchen Preis und zu welcher Lust sein vor Scham verlorener Körper wiederkehrt, erzählt Fred selbst so lebendig, wie man es beim Durchblättern von Fotoalben macht: "Das war am Schlachtwursttag / auf unserer Farm bei Dungog. / Das sind mein Vater Reinhard Böttcher / und meine Mutter Agnes und mein Bruder Frank, / der später starb am Hirnbrand, Meningitis." Das Demonstrativpronomen "Das" führt medias in res, als ginge es gegen Milton, Pound und Walcott um den Weltrekord im Epenbeginnen - und in dieser Intensität läßt der australische Dichter Les Murray seinen Helden weitersprechen. Fred erzählt die vierunddreißig Jahre von August 1914 an bis nach der Ermordung Gandhis 1948, zwei Weltkriege, Armut, Rassenwahn, Atombombe.
Fred gelangt zunächst durch die Wirren des Ersten Weltkriegs im Nahen Osten nach Hause, findet aber die Farm verwaist. Der Vater ist am Kummer über die Ächtung als Deutscher gestorben, die Mutter unbekannt verzogen. Auf der Suche findet Fred bei einem Kriegerdenkmal seine spätere Frau Laura, die Witwe eines der auf dem Stein Eingravierten. Die Beziehung droht mehrfach zu zerbrechen, denn Laura merkt natürlich, daß Fred nichts spürt, wenn er sie berührt. Dennoch wird ein Sohn geboren. Fredys Mutter wird wiedergefunden, doch bald an einen Deutschnationalen verloren, mit dem sie schließlich nach Dresden zurückgeht. Die kleine Familie lebt in äußerster Armut, Fred arbeitet als Möbelpacker. Als er an einer Delogierung mitwirken soll, wendet er sich handgreiflich gegen die amtshandelnde Polizei und muß in die Vereinigten Staaten fliehen, wo er zunächst als Bodyguard in einem als Irrenhaus getarnten Mafiaquartier wohnt. Später trampt Fred als Hobo quer durch die Wirtschaftskrise, ehe er in Hollywood als Statist für deutsche Militärchargen unterkommt und Marlene Dietrich begegnet.
Bei einer Flugschau kommt es zu einem Zwischenfall, der Fred eine Zeppelin-Passage ins Deutschland von 1932 einträgt. Eine letzte Begegnung mit der Mutter führt zu keiner Verständigung mehr. Fred arbeitet nun in der Crew eines Zeppelins, erlebt die Machtergreifung 1933, fliegt in geheimer Mission nach Rußland, wo die NKWD-Säuberungen beginnen, schlägt sich mit einer SA-Horde herum, die einen Juden erniedrigt, taucht ab in einen Zirkus, rettet ein geistig behindertes Kind vor der Kastration und gelangt mit diesem schließlich zurück nach Australien.
Das wirkt unwahrscheinlich im ganzen, ist in den Details aber wahr wie die wahnsinnige Wirklichkeit. Freds Leib bleibt taub und übermenschlich, wie es auch notwendig scheint zum Ertragen von Armut und zum Überleben der pazifischen Inselkämpfe als australischer Reservist. Und dann sieht der Heimkehrer den Atompilz in der Wochenschau: "Ich hörte mich selbst sagen: Der Hermaphrodit! Der Hermaphrodit, / beinahe laut. Ich glaube, was ich meinte, war, daß jetzt der Krieg für Frauen / und Männer gleich war." Fast löst der Schock des Bildes die Verstocktheit des Körpers, doch Fred will nicht durch das Böse geheilt werden. So dauert es noch einige Friedensjahre unter Kriegskrüppeln und Traumatisierten, darunter sein eigener Sohn, ehe die Heilung einsetzt: Fred beginnt mit ungeteiltem Herz zu beten und allen zu vergeben - auch den Opfern, auch Gott.
Aha, wird mancher sagen, daher weht der Wind. Und was ist mit den Toten? Wer soll dies alles glauben? Diese Fragen hat sich auch Les Murray gestellt: "Wie gut ist dein Gedicht? Kann es sie wieder / lebendig machen nach dem Tanz im Kerosin?" Nein, es kann nicht - und es kann doch, indem es die Sprache der Opfer spricht, nicht die des hochsprachlichen Epos. Die Sprache des Buchs ist die der australischen Landarbeiter, und in diesem sermo humilis spiegeln sich die Sprachen der Welt - von Türkisch bis Schwyzerdütsch -, durchbrochen von Germanismen wie "stood watch / stand Wache". Thomas Eichhorn hat als Übersetzer des 1998 erschienenen Originals Herkulisches geleistet, zahllose Rätsel geklärt, Wortspiele bewahrt und einen eigenen Ton gefunden. Jeder kann dies in der prächtigen zweisprachigen Ausgabe nachprüfen. Bloß das Vokabular hätte bisweilen kräftiger ausfallen können. "Bullshit" heißt nun einmal nicht nur "Schwachsinn", und leider gerät auch jene Stelle etwas matt, an der mit den Nazis abgerechnet wird, die "den Schließmuskel des Guten lockern". Nein, sie ließen ihn fahren: "letting go the sphincter of Good".
Dieser eines Jandl oder Gadda würdige Fluch lokalisiert das Gute als die unterste physische Grenze in den Eingeweiden jedes einzelnen Menschen und bannt das braune Unwesen durch Kunst. Murray "hat eine Syntax erschaffen, die Eisen frißt und Blütenblätter ausspuckt" (Derek Walcott). Eine Autofahrt durch die Vereinigten Staaten liest sich dann so: "Wir rasten durch Tage von Land. Große schnelle Plakate: Pillsbury's / Franklin Auto Syrup." Tausend Meilen schnurren durch reziproke Metaphorik in einem Zoomeffekt zu Nonsens zusammen und dehnen sich in der Phantasie des Lesers wieder aus - so hätten Surrealisten und Futuristen gern dichten können. Die erzählerische Phantasie Murrays läßt Fred grübeln: "War ich der Anfang einer neuen Rasse, von der's noch keine Frauen gab? / So wie der erste Mensch, der nur mit Affen schlafen konnte, / wenn die Religion im Unrecht war. Der muß sich / komisch vorgekommen sein, ganz warm und dusselig mit seinen Nächsten, / doch aufrecht im Geheimnis, nicht zufrieden mit Geschnatter, und zu nackt."
Die ästhetische Zumutung von Les Murrays Buch besteht darin, daß es fast nur aus Pointen besteht und der Leser stets mit der eigenen Dummheit zu kämpfen hat, ehe er die obszönsten und zartesten Stellen versteht. Diese mächtige Sprache ist es aber auch, die Fred das Schlimmste erzählen läßt. Das Gesicht des geträumten toten Vaters "war schwarz wie Leber und so klein". Auch das Gesicht des ukrainischen Muskelmannes, der sich nach Stalins Genozid erhängte, frißt sich ins Gedächtnis: "sein dünnes Blondhaar über einem / riesigen schwarzen Boxhandschuh, und seine Zunge war der Daumen". Die nationalsozialistischen Verbrechen werden nicht direkt erzählt, aber Murray kennt die Berliner Adresse, an der sie erdacht wurden: "Tiergartenstraße 4", die "Euthanasie"-Zentrale. Wenn die verhinderte Kastration eines Kindes als zentrales Beispiel für die NS-Greuel dient, so zeigt dies zweierlei: wie diese Ideologie sogar Eltern dazu bringt, ihr eigenes Kind im Stich zu lassen - und daß die damaligen australischen Gesetze in bestimmten Fällen das gleiche erlaubten.
Dadurch, daß Murray den Holocaust nur andeutet, wird der Blick frei für das Immergleiche der "Polizei-Revolution" des zwanzigsten Jahrhunderts: Die uniformierte Mehrheit, die Minderheiten quält, hetzt, tötet. In Australien sind es die Aborigines, denen man das Land, die Kinder und die Zurechnungsfähigkeit raubt, und daher ist es konsequent, daß Sam, Freds bester Freund und Lehrer, von beiden ältesten Völkern abstammt: den Aborigines und den Juden. Sam gibt den Auftrag, die Geschichte zu erzählen, doch fällt durch ihn auch ein unauflösbarer Schatten auf Freds Namen. Sam ertränkt sich unmittelbar vor der Küste Australiens. Das bloße Überleben macht Neptune zum Täter.
Wer aber ist Fredy Neptune wirklich? Was bedeutet die Widmung "To the glory of God"? Fred ist eine Generation älter als Les Murray, der 1938 als Nachfahre schottischer Einwanderer, aber sonst in recht ähnlichen Verhältnissen aufwuchs wie Fred. Wenn also "Fredy Neptune" die "heimliche Autobiographie" von Les Murray ist - so der Dichter in einem Essay im Anhang -, dann nicht als Zeitgenosse, sondern als Vorgänger. Man kann nun psychologisierend auf diese Figur Murrays Depressionen projizieren, die er selbst in "Killing the Black Dog" (1997) dargestellt hat.
Aber die biographische Lesart greift zu kurz. Fred ist mehr. Er ist in gewissem Sinn auch Christus. Einen Hinweis liefert ein religiöser Irrer, der in Fredy "das Wort des Körpers" erkennt. Nimmt man dies ernst, wird der theologische (und poetische) Grund des Buches sichtbar. Dadurch, daß der Mensch sich selbstlos mit seinem leidensfähigen Körper identifiziert, kann er "das ewige Leben spüren". Nicht das im Jenseits, sondern dieses hier. Der bekennende Katholik Murray entwindet allen Rassisten und Ideologen den Körper und gründet auf das Mysterium der Inkarnation die Demokratie des Mitleids. Wer einen Leib hat, steht immer auf beiden Seiten - wie Gott. Den Zweiflern bleibt die Freude am kühnsten Gedicht des zwanzigsten Jahrhunderts.
Les Murray: "Fredy Neptune". Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Eichhorn. Zweisprachige Ausgabe. Ammann Verlag, Zürich 2004. 520 S., geb., 29,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main