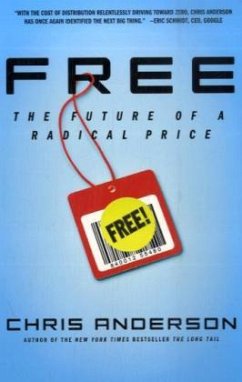Produktdetails
- Verlag: HarperCollins UK
- Seitenzahl: 256
- Erscheinungstermin: 3. August 2009
- Englisch
- Gewicht: 245g
- ISBN-13: 9781401310011
- ISBN-10: 140131001X
- Artikelnr.: 26149479
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Wer im Internet rechtzeitig auf Geld verzichtet, dem kann später reichlich gegeben werden: Chris Anderson schwört auf die entfesselte Kostenloskultur ein - und übersieht dabei einiges.
Mit dem Internet entstand der Gedanke der Geschenkökonomie, und es sieht danach aus, als würde er so schnell nicht wieder verschwinden. Die an sich seltsame Vorstellung, man könne einen Bereich der Wirtschaft von der Entlohnung ausklammern, während man in anderen Sektoren wie bisher zu zahlen bereit ist, hat sich im Bewusstsein der internetsozialisierten Generation festgesetzt und auf der Seite der Produktion auch ein starkes Argument für sich: die sinkenden Distributionskosten im virtuellen Raum. Die digitale Welt schreitet nach dem Mooreschen Gesetz voran, jener Regel, der zufolge sich alle eineinhalb Jahre die Bandbreite, die Speicherkapazität und die Prozessorengeschwindigkeit verdoppeln. Es wird immer billiger, digitale Güter zu speichern und zu vervielfältigen. Warum sie nicht gleich verschenken?
Weil immer noch die Kosten für die Anfertigung des Primärprodukts ins Gewicht fallen, lautete der simple Einwand. Chris Anderson erklärt jedoch auch diese letzte Schranke zur vernachlässigbaren Größe. Der Chefredakteur des amerikanischen Technikkulturmagazins "Wired" hat ein radikales Plädoyer für eine universelle Kostenloskultur verfasst, das die Ideologie des Verschenkens auf ihre wirtschaftlichen Füße stellt. "Informationen wollen kostenlos sein, so wie das Leben sich verbreiten und Wasser abwärtsfließen will", schreibt er überraschend für jeden Leser, der noch nicht wusste, dass Informationen über einen eigenen Willen verfügen. Das Freilegen der Sichtachse auf revolutionäre Entwicklungen soll mit dem Pathos naturwüchsiger Notwendigkeit beginnen.
Andersons These ist einfach: Wir leben, was den digitalen Raum betrifft, im Überfluss. Die Zeiten, in denen Preise mit Knappheitsargumenten und Verteilungskosten begründet wurden, sind vorbei. Es gibt bei digitalen Gütern fast keine Grenzkosten mehr. Und wo diese minimal werden, sollte man ganz auf ihre Berechnung verzichten. Wer diesen Schritt als Erster vollzieht, tut es mit großem Gewinn, weil er auf einen psychologischen Effekt hoffen kann: Wo etwas umsonst zu bekommen ist, ist es mit kühlem Abwägen vorbei und ein fiebriges Habenwollen greift Raum. Der Gratisverteiler ist der Konkurrenz im Absatz seiner Ware bald meilenweit voraus, aber immer noch eine arme Kirchenmaus. Womit soll er Gewinn erwirtschaften, wenn er seine Produkte verschenkt?
Mit anderen Dingen. Das Kernprodukt gibt es kostenlos, der Verdienst kommt mit finanziell attraktiveren Komplementärprodukten, lautet Andersons Hauptregel. Er ist nicht um Beispiele verlegen, den Erfolg dieses Prinzips zu demonstrieren: Das gilt für Google, das mit Werbung so viel Geld verdient, dass es sein Suchmaschinenangebot und viele andere Dienste umsonst anbieten kann. Es gilt für Telefonunternehmen, die Handys verschenken, um mit den Tarifen ihren Gewinn zu machen. Es trifft auch auf traditionelle Sparten zu, etwa den Rasierklingenhersteller, der Rasierer verschenkt, um den Klingenabsatz anzukurbeln.
Die Geschenkökonomie ist damit kein Kind des Internet. Auch der zweite Weg in die Kostenlosökonomie, bei dem ein gratis verteiltes Produkt durch Werbung Dritter finanziert wird, ist nicht neu. Man wird den Verdacht nicht los, dass all diese Geschenke am Ende doch bezahlt werden müssen, weil der Werbeaufwand im Preis für das beworbene Produkt enthalten ist. Doch selbst der Einwand, dass der Internetbesucher, wohin er seinen Cursor wendet, mit Werbung überspült wird, dämpft Andersons Euphorie nicht.
Was für Google gut ist, muss für andere Unternehmen nicht billig sein. Für Firmen, die keine Komplementärprodukte griffbereit haben, heißen Andersons Sekundärwährungen Aufmerksamkeit und Reputation. Wer sie in großem Maß auf sich ziehen kann, indem er seine Werke kostenlos anbietet, wird daran keinen Schaden nehmen, weil er nun so bekannt ist, dass er später leicht Gewinn daraus schlagen kann - womit auch immer. Anderson listet die Beispiele von Künstlern auf, die mehr aus Zwang denn aus Überzeugung dazu schritten, ihre Dinge im Internet kostenlos zu veröffentlichen, im Bewusstsein, andernfalls ohnehin Opfer von Piraterie zu werden. Von Radiohead, die ihr letztes Album als kostenlosen Download anboten, weil sie den Verlust mit Konzerten und Merchandising ausgleichen konnten, bis zu dem Esoterik-Autor Paulo Coelho, der seinen Roman im Netz frei zugänglich machte und dann immer noch ausreichend Käufer seines gedruckten und ungleich bekannter gewordenen Buches fand. Auch die Piraterie muss in dieser Hinsicht kein Übel sein, meint Anderson. Sie verhelfe dazu, ein Produkt populär zu machen. Diejenigen, die es dann tatsächlich kaufen, prophezeit er, werden nicht wenige sein.
Anderson vertraut in der Wahl seiner Beispiele dem Starsystem. Es sind etablierte Größen, für die diese Rechnung aufgeht, und eine begrenzte Anzahl von Neuankömmlingen, die auf diesem Weg erfolgreich werden können. Doch das Gesamtvolumen an Aufmerksamkeit ist nicht beliebig dehnbar, der Reputationsgewinn des einen ist der Verlust des anderen. Bekanntheit ist jedoch Pflicht für den, der in der Geschenkökonomie reüssieren will.
Auch einen anderen prinzipiellen Zweifel kann Anderson nicht ausräumen: dass mit der Geschenkökonomie die Gefahr des Marktmonopolismus wächst und einige wenige den Gewinn auf Kosten vieler anderer machen. Wer den Werbemarkt wie Google beherrscht, kann es sich leisten, andere Produkte zu verschenken, gräbt damit aber gleichzeitig das Geschäftsmodell vieler anderer ab. Deutlich wird das am Beispiel von Craigslist, einem Internetangebot für kostenlose Kleinanzeigen, das amerikanischen Zeitungsverlagen seit seiner Gründung mindestens 30 Milliarden Dollar Wertverlust an der Börse eingebracht haben soll, selbst aber gerade einmal genug Gewinn zum wirtschaftlichen Überleben macht. Der gesamte Umsatzverlust auf dem Anzeigenmarkt wird dadurch nicht annähernd ausgeglichen. Der Nachweis, dass man den publizistischen Substanzverlust kompensieren kann, steht noch aus.
Anderson hat sein Plädoyer aufs große Ganze hin geschrieben, ohne es auf die Belange einzelner Wirtschaftsbereiche abzustimmen. Ob daraus ein funktionsfähiges Gesamtmodell werden kann oder nur ein Ruinenfeld mit wenigen steil aufragenden Säulen, bleibt genauso offen wie die Frage, in welchem Umfang das Gratismodell Anwendung finden soll. Anderson rät einmal zu vorsichtiger Dosierung, dann lässt er seinem visionären Elan wieder freien Lauf. Eine gekürzte Version seines Buches hat er als kostenloses Audiobook im Internet veröffentlicht. In fünf Wochen wurde es 170 000 Mal heruntergeladen. Zweifellos ein Erfolg. Es ist davon auszugehen, dass das gedruckte Buch trotzdem noch viele Käufer finden wird. Sein Autor ist bekannt und hat eine steile These. Lässt sich daraus schon ein allgemeingültiges Erfolgsrezept ableiten?
THOMAS THIEL
Chris Anderson: "Free". Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets. Aus dem Englischen von Birgit Schöbitz und Dzifa Vode. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2009. 304 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Turns traditional economics upside down Guardian