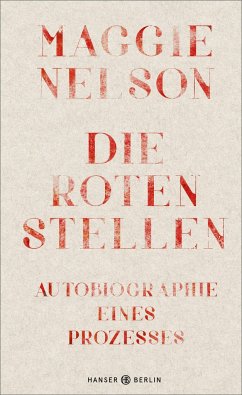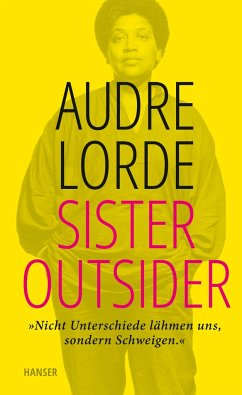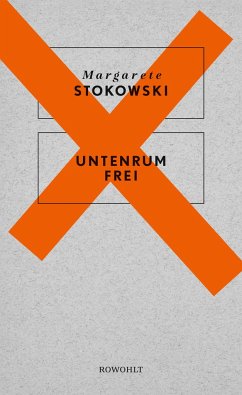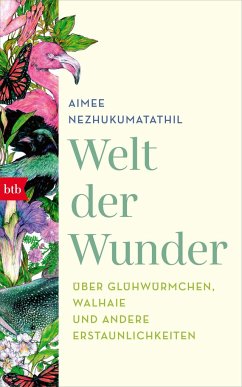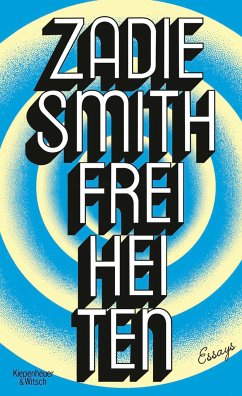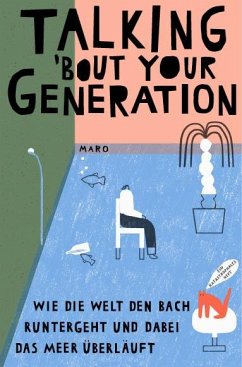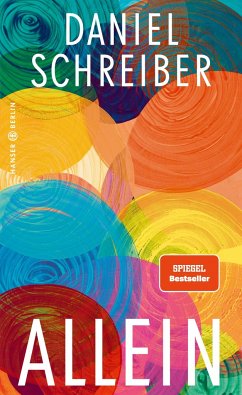"Maggie Nelson ist eine eigenwillige Denkerin. Im Grenzbereich zwischen Dichtung, Kritik, Essayistik, Literatur und Theorie mischt sie nicht nur die Genres. Sie bringt auch den subjektiven Faktor ins Spiel. .... Ihr wacher Geist fängt die Dinge im Flug, sie hat eine gute Intuition für die wunden Stellen von Begriffen. Und ihr fällt ein, wie man sie reparieren kann. ... Es weht etwas von jener Freiheit in dieses Buch hinein, die man mit Kalifornien, mit Sonne, Meer und hohem Himmel verbindet." Meike Feßmann, Tagesspiegel, 30.03.22 "Ich bin ein großer Fan von Maggie Nelson. ... Voraussetzungsreich, aber unglaublich anregend. ... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zusammen zu denken; ich glaube, das ist die Einladung, die sie macht. "
Lisa Kreißler, NDR Kultur, 01.05.22 "Der stilistische Einfluss von Maggie Nelson auf die aktuelle deutschsprachige Literatur ist kaum hoch genug einzuschätzen: Es ist vielerorts ein mehr oder weniger eingestandenes Nacheifern und Abkupfern ihrer Schreibweise zu beobachten, die ... theoretisch schwer bepackt ist und doch leichthändig mit Einflüssen aus allen Künsten und Epochen jongliert ... Werke von Maggie Nelson zu lesen bedeutet, sich in ein Netz der Intertextualität zu begeben ... Hilfreich und heilsam." Jan Wiele, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.07.22 "Maggie Nelson zieht einer moralisch getriebenen Freiheitsdiskussion gleich zu Beginn den Zahn und geht direkt zu den Wahrheiten, die wehtun: Wer frei sein will, belastet andere, und Freiheit ist oft mit Pflicht, Schuld und Sorge verbunden. ... Nelson ist Poetin und das ist gut so, denn dadurch nähert sie sich diesem komplexen Thema mit dem nötigen spielerischen Mut zur Ambivalenz." Miguel Peromingo, Galore, 07.04.22 "Maggie Nelson plädiert für Ehrlichkeit, also Sex weder zu idealisieren, noch zu verdammen. ... Und sie behält, was die lakonische Souveränität dieses Textes ausmacht, ihren Sinn für feine Ironie ... Maggie Nelson sagt selbst, dass sie immer nach Texten gesucht habe, die das erotische Erleben von Frauen beschreiben. ... Es [ist] ihr gelungen, einen neuen, sehr wichtigen hinzuzufügen." Martin Zeyn, BR 2, 15.03.22 "Nelson zu lesen bedeutet im Grunde, ihre Bibliothek zu durchforsten nach Autorinnen und Autoren, an denen sie sich abarbeitet, die sie besonders schätzt, deren Ansichten sie teilt oder hinterfragt. ... Oft entscheidet sich Nelson für ein Abwägen strittige Positionen anderer, ohne zu einem eigenen Urteil zu kommen. ... Nelson gebührt Respekt dafür, dass sie die kritische Haltung einer Geisteswissenschaftlerin angesichts eines so emotional und nostalgisch verklärten Themas bis zum Ende durchhält." Anne-Sophie Balzer, Berliner Zeitung, 19./20.03.22 "Nelson fordert größtmögliche Komplexität und Offenheit. So wackelig ihre Argumentation bisweilen bleibt, genau das macht den Reiz dieser Lektüre aus: Man muss sich dazu in Beziehung setzen. Nelson fasst aktuelle Diskurse leicht lesbar zusammen, verankert sie konkret (oft in ihrem eigenen Leben)." Karin Cerny, profil, 17.07.22 "Nelson plädiert für mehr Toleranz gegenüber komplexen und vielleicht verstörenden Ideen und Kunstwerken. ... Sie gehört zu den wichtigsten Stimmen der feministischen und queeren Literatur und Theorie des vergangenen Jahrzehnts. ... Leitmotiv ist dabei Nelsons Plädoyer, Komplexität und Ambiguität auszuhalten, statt sich in Verfolgungswahn und Bestrafungs- und Ausschlusslogik zu ergeben." Caspar Shaller, Süddeutsche Zeitung, 05.05.22 "In Zeiten autoritärer Identitätspolitik sollte Nelsons radikale und risikoreiche Reflexion über Freiheit Pflichtlektüre für alle Literatur- und Kunstfans sein." Thomas Ballhausen, Buchkultur 3/22, 15.06.22