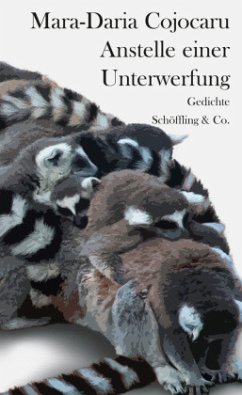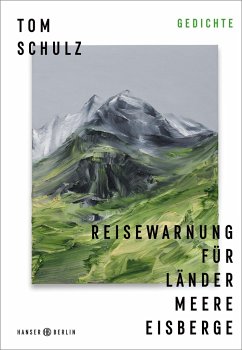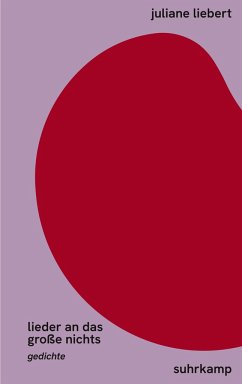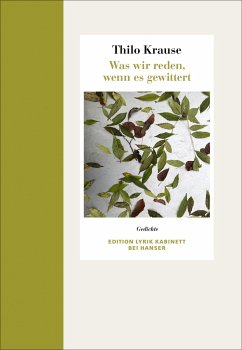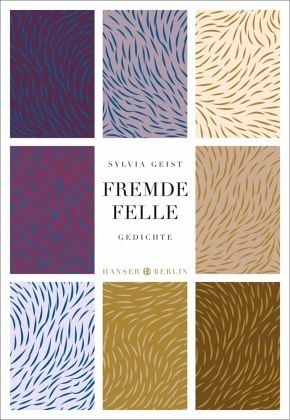
Fremde Felle
Gedichte
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In der Großstadt, in vermeintlichen Landidyllen, in den Grauzonen der Suburbs - überall begegnet in Sylvia Geists neuem Lyrikband dem Einzelnen die Wildnis, die in ihm selbst steckt. Mit glasklarem Verstand und sinnlicher Bildersprache erkunden diese Gedichte, wie weit wir gekommen sind, seit wir angefangen haben, uns in fremde Felle zu kleiden. Ob Geists Figuren in die Haut von Füchsen schlüpfen, die Okkupation ihres Hauses durch Rehe fürchten oder die Sehnsucht nach menschlicher Wärme unter der Trockenhaube stillen, immer sind sie auf der Spur der Welt, die wir mit den anderen teilen -...
In der Großstadt, in vermeintlichen Landidyllen, in den Grauzonen der Suburbs - überall begegnet in Sylvia Geists neuem Lyrikband dem Einzelnen die Wildnis, die in ihm selbst steckt. Mit glasklarem Verstand und sinnlicher Bildersprache erkunden diese Gedichte, wie weit wir gekommen sind, seit wir angefangen haben, uns in fremde Felle zu kleiden. Ob Geists Figuren in die Haut von Füchsen schlüpfen, die Okkupation ihres Hauses durch Rehe fürchten oder die Sehnsucht nach menschlicher Wärme unter der Trockenhaube stillen, immer sind sie auf der Spur der Welt, die wir mit den anderen teilen - einer Welt, in der das Echo massenhaft "die Felsen bespringt" und bereits die "Särge für das letzte bisschen Eis" angefertigt werden.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.