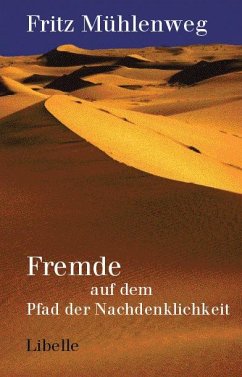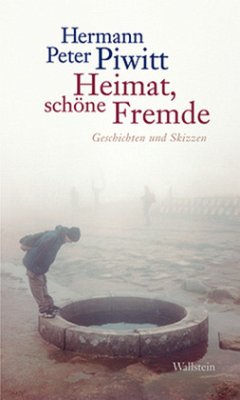Nicht lieferbar

Fremde Mutter
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Es ist ihr Lebensbericht, den Elisabeth einem jungen Arzt erzählt. Sie ist erst siebenundzwanzig. Früh war der Vater gestorben und die Kindheit nach dem Ersten Weltkrieg in dem kleinen Dorf in Deutschland voll Entbehrungen. Die Mutter ist eine schweigsame und strenge Frau. Erst viele Jahre später, kurz vor ihrem Tod, wird Elisabeth ihr nahe sein. Aus dem Kind reift eine selbstbewusste Frau heran, die ihr Leben trotz vieler Schicksalsschläge zu meistern versteht. Bei einem Urlaub in der Ostmark lernt sie ihren Mann kennen und lieben. Doch der Krieg Nazideutschlands setzt dem Glück ein jäh...
Es ist ihr Lebensbericht, den Elisabeth einem jungen Arzt erzählt. Sie ist erst siebenundzwanzig. Früh war der Vater gestorben und die Kindheit nach dem Ersten Weltkrieg in dem kleinen Dorf in Deutschland voll Entbehrungen. Die Mutter ist eine schweigsame und strenge Frau. Erst viele Jahre später, kurz vor ihrem Tod, wird Elisabeth ihr nahe sein. Aus dem Kind reift eine selbstbewusste Frau heran, die ihr Leben trotz vieler Schicksalsschläge zu meistern versteht. Bei einem Urlaub in der Ostmark lernt sie ihren Mann kennen und lieben. Doch der Krieg Nazideutschlands setzt dem Glück ein jähes Ende. In ihrem Schmerz begeht Elisabeth einen Akt des Widerstandes, der ihr einzig richtig erscheint.In ihrem neuen Roman schildert Christine Haidegger ein authentisches Stimmungsbild der Zwischenkriegszeit. Bisher nur mit der unmittelbaren Gegenwart beschäftigt, wird aus einer jungen Frau eine Beobachterin der politischen Verhältnisse. In den schwierigsten Zeiten des 20. Jahrhunderts wächst sie durch Selbstbestimmung und Anteilnahme über sich selbst hinaus.