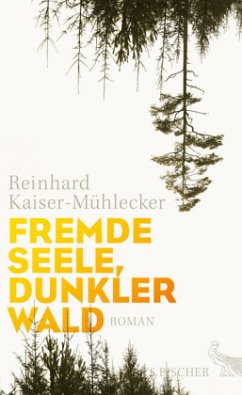Reinhard Kaiser-Mühlecker schreibt die Geschichte zweier Brüder und ihrer Heimat in Oberösterreich - ein mit biblischer Wucht erzählter Roman um Missverständnisse, Tötungen, Familientragödien und Befreiungsversuche.
Alexander kehrt von seinem Auslandseinsatz als Soldat internationaler Truppen in die Heimat zurück. Seine Unruhe treibt ihn bald wieder fort. Sein jüngerer Bruder Jakob führt unterdessen den elterlichen Hof. Als sich sein Freund aufhängt, wird Jakob die Schuldgefühle nicht mehr los. Der Vater fabuliert von phantastischen Geschäftsideen, während er heimlich Stück für Stück des Ackerlandes verkaufen muss. Mit großer poetischer Ruhe und Kraft erzählt Reinhard Kaiser-Mühlecker von den Menschen, die durch Verwandtschaft, Gerede, Mord und religiöse Sehnsüchte aneinander gebunden sind. Es ist die Geschichte zweier Brüder, die dieser Welt zu entkommen versuchen - eine zeitlose und berührende Geschichte von zwei Menschen, die nach Rettung suchen.
Alexander kehrt von seinem Auslandseinsatz als Soldat internationaler Truppen in die Heimat zurück. Seine Unruhe treibt ihn bald wieder fort. Sein jüngerer Bruder Jakob führt unterdessen den elterlichen Hof. Als sich sein Freund aufhängt, wird Jakob die Schuldgefühle nicht mehr los. Der Vater fabuliert von phantastischen Geschäftsideen, während er heimlich Stück für Stück des Ackerlandes verkaufen muss. Mit großer poetischer Ruhe und Kraft erzählt Reinhard Kaiser-Mühlecker von den Menschen, die durch Verwandtschaft, Gerede, Mord und religiöse Sehnsüchte aneinander gebunden sind. Es ist die Geschichte zweier Brüder, die dieser Welt zu entkommen versuchen - eine zeitlose und berührende Geschichte von zwei Menschen, die nach Rettung suchen.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Tim Caspar Boehme möchte nicht tauschen mit der dysfunktionalen Familie in ihrem Elend, in dieser österreichischen Ödnis, die Reinhard Kaiser-Mühlecker laut Boehme dramaturgisch geschickt pointiert und mit Ruhe- und Spannungsmomenten schildert. Allerdings ahnt er, dass er auch nicht allzu weit davon entfernt ist. Weit mehr als ein Familienroman um zwei Brüder auf dem elterlichen Hof scheint dem Rezensenten der Text zu sein, weil der Autor darin das Leben an sich als Gefängnis reflektiert. Die altertümliche Sprache, die er dazu wählt, findet Boehme passend, und die nüchterne Bildlichkeit, die nur zuweilen poetisch wird, lässt ihn ganz nah an das Personal heran.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Leere Transzendenz: In "Fremde Seele, dunkler Wald" seziert Reinhard Kaiser-Mühlecker die brüchige Harmonie von Dorf, Wald und Wiese und lässt seine Helden komfortabel in der Moderne stranden.
Irgendwie, irgendwo, irgendwann sind im Erzählkosmos von Reinhard Kaiser-Mühlecker keine Füllsel, sondern die oft einzigen Vektoren für das Innenleben seiner Figuren. Diese Helden fahren nicht auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Sie baumeln im Unbestimmten zwischen einer Vergangenheit, die nicht vergehen soll, über der aber schon ein halb verwester Geruch liegt, und einer Gegenwart, die sich nicht einstellen will. Die in wenigen Strichen gesetzten modernen Elemente sind hier in einer aparten Alltäglichkeit aufgehoben, die Archaisches, Ländliches hervortreten lässt. Als wollte der Autor sagen: Es gibt diese zeitfremde Erfahrung auch, und es ist eine Frage der Beharrlichkeit, sie ohne idyllisierende Züge glaubhaft zu machen. "Salz flog vom Streuteller am Heck des Lastwagens durch orange flackerndes Licht auf die Straße und zerfraß den Schnee."
In seinem neuen Roman "Fremde Seele, dunkler Wald", mit dem er jetzt auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gelangt ist, bleibt Kaiser-Mühlecker diesem Schema treu und setzt die Welt konsequent in Fragezeichen. Anfangs gerät dies holprig. Die unablässige Selbstbefragung der Protagonisten und der verschwenderische Gebrauch von Auslassungspunkten erzeugen einen Nachhall, den das Erzählte noch nicht trägt. Dann entfaltet der gediegene, aber nicht biedere Tonfall seinen gewohnten Sog.
Wie in seinen vorigen Romanen lässt Kaiser-Mühlecker seine Erzählung um die eigene Herkunftswelt, ein Bauernhaus im Oberösterreichischen, gravitieren, in das sich die beiden Protagonisten, Alexander und Jakob Fischer, nach mehr oder minder gescheiterten Versuchen, im Leben Fuß zu fassen, zurückziehen, um es nach längerer (Jakob) oder kürzerer (Alexander) Zeit wieder zu verlassen. Das bäuerliche Idyll ist innerlich porös. Bewohnt wird es von einem verlebten Großvater, der sich auf die selbstsüchtige Verwaltung seines Vermögens beschränkt und der bornierten Großmutter das Regiment überlässt. Der Vater ist ein Phantast, der Haus und Hof verspielt, in der Rolle des Glücksritters aber noch stimmiger wirkt als in der schwindsüchtigen Melancholie nach dem Verlust seiner letzten Spielkarte.
Irgendwann taucht ein fremder Traktor auf dem Feld auf und verbreitet mit ausgelassener Gülle einen beißenden Geruch. Von diesem Moment an weiß der jüngere Jakob, dass die Welt seiner Herkunft verloren ist, die ihm trotz ihres inneren Unfriedens Halt geboten hatte, weil er sie innerlich fremd, als eine Art mittätiger Gast, bewohnt hatte, und weil ihm Felder, Wald und Wiesen immer ein seelisches Naherholungsgebiet geboten hatten. Freilich ist auch dieses von moderner Infrastruktur angefressen, die sich als Riese, der in mächtigen, metallischen Schritten über die naheliegende Autobahn tappt, in Jakobs Tagträume schleicht.
Kaiser-Mühlecker macht die Risse im inneren und äußeren Gefüge der Figuren über kunstvolle Naturbilder und erdige Gerüche erfahrbar, über seiner Erzähllandschaft liegt eine fahles, winterliches Licht. "Am westlichen Ende der Weide, wo das Gelände sanft anstieg, begannen sich Inseln aus Nebel zu bilden, die sich, keine Handbreit über den Halmen, auf irgendeine unnachvollziehbare Art und Weise bewegten, zerflossen und sich zugleich ständig neu formierten - Menschen ähnlich, die ziellos umhergingen, verschwanden, wiederkamen oder wegblieben."
Ziellos im Nebel wandernd, werden Jakob und Alexander von starken Empfindungen jäh ergriffen und verlassen. Ihr Leben folgt mehr Ahndungen, Schicksalslinien als selbstgewählten Zielen, ihren Witterungen folgen sie aber konsequent. Der ältere Alexander entkommt dem bäuerlichen Milieu in ein Stiftsgymnasium, widmet sich später mit gleichem Ernst Militärstudien, an denen er als in der Fremde stationierter Soldat das Interesse verliert, und verstrickt sich in Gelegenheitsbeziehungen. Nach einer verpassten Liebe hebt er die Leere in schmerzvoll-genießerischer Distanz am Comer See auf, mit der Rückkehr in den Militärdienst stellt sich der Aschengeschmack des Alltags wieder ein.
Der etwas handfester angelegte, aber sinnesverwandte Jakob bleibt auf dem Hof zurück, führt ihn, ohne Anerkennung zu finden, bald in Eigenregie. Eine in innerer Distanz geführte und später mit Hass erlebte Beziehung bringt ihn eine Zeit vom Hof, zurückgekehrt fasst er in der alten Welt nicht mehr Fuß. Der Selbstmord eines alten Schulfreundes lässt ihn gerüchteweise zum Verdächtigen werden. Auch sein Bruder wird von den dörflichen Gerüchteküche aus der Ferne sonderbar intrigiert. In der von altchristlichem Schicksalsglauben umwehten Herkunftswelt werden beide von unbestimmten Schuldgefühlen niedergedrückt und können dem bäuerlichen Fatum nicht entfliehen.
Das Eigentümliche ist, dass sie die Entgleisungen aus der Lebensspur nicht als persönliches Versagen, sondern als Zwangsläufigkeit und sogar als Erleichterung erfahren, weil sie ihnen den Rückzug in eine Innenwelt auftun, in der sie sich heimatlicher fühlen. Doch auch die innerlich gewendete Seele will von außen illuminiert werden. Zum zweiten Gravitationspunkt macht Kaiser-Mühlecker eine Sektenführerin, der in der dörflichen Gemeinschaft viel Böses nachgesagt wird. Die milde Erhebung im Sektenkreis schildert Kaiser-Mühlecker nicht als dogmatische Verführung, sondern als legitime Form des zeitlichen Eskapismus, dem sich die Helden in einem distanziert religiösen Bewusstsein hingeben. "Nie sonst im Wachen löste die Zeit sich so auf wie bei langem Warten, nie sonst wurde sie so belanglos. Nie sonst in der Nüchternheit löste man sich so von sich selbst und gelangte in einen Zustand, der nur jenem des spielenden Kindes vergleichbar war."
Ist es noch ein Vorzug, dass Kaiser-Mühlecker dieses Nirwana nicht als verborgen sprudelnden Sinnquell präsentiert, dass er Neues und Altes nicht gegeneinander ausspielt, sondern wie tektonische Platten verschiebt, so wirkt es doch ratlos, wenn er die Brüche am Ende mit einem harmlosen Idyll übermalt, das er seinen Helden wie ein ZDF-Fernsehdrehbuch unterschiebt.
THOMAS THIEL
Reinhard Kaiser-Mühlecker: "Fremde Seele, dunkler Wald". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2016. 304 S., geb., 20, - [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Wie er aus der hilflosen Stummheit, die seine Protagonisten anfällt, Literatur macht, ist virtuos. Christoph Schröder Zeit Online 20160830