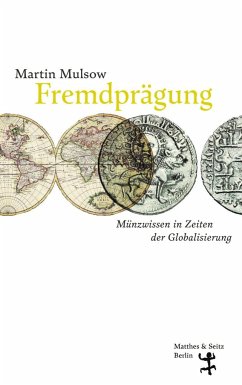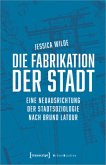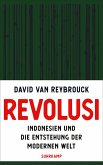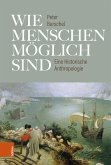Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Asien intellektuell einkreisen: Martin Mulsow macht mit Münzgelehrten als Akteuren der frühneuzeitlichen Globalisierung bekannt
Geld und Globalisierung - diesem breitgetretenen Thema gewinnt Martin Mulsow bisher unbekannte Tiefendimensionen ab. Nachdem der renommierte Frühneuzeithistoriker mit "Überreichweiten" vor Kurzem einen ersten Band zur globalen Ideengeschichte des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts vorgelegt hat (F.A.Z. vom 26. November 2022), folgt nun ein zweiter Teil, der sich mit dem "Münzwissen in Zeiten der Globalisierung" beschäftigt. In sieben Kapiteln behandelt Mulsow, wie Gelehrte des Barocks und der Aufklärung versuchten, Münzen aus China, Zentralasien, Indien, Sibirien, Arabien und Persien, aber auch aus der keltischen Antike oder dem frühen Mittelalter verständlich zu machen.
Was auf den ersten Blick wie ein marginaler Nebenkriegsschauplatz erscheinen mag, wird in Mulsows bestechender Darstellung zur großen Bühne von Globalisierungsgeschichte, etwa wenn die numismatischen Aktivitäten kaum bekannter Gelehrter wie Georg Jakob Kehr in Arnstadt oder Jakob von Melle in Lübeck um 1700 vorgestellt werden.
Weil fremde Münzen zu einem Prestigeobjekt für Fürsten und reiche Mäzene geworden waren, fanden immer welche über die Handelsorganisationen, Missionsorden und Kolonialverwaltungen den Weg selbst in die Peripherien Europas. Dort wurden sie für ambitionierte Gelehrte zum Anlass, Geschichte und Lebenswelt ferner Weltgegenden zu erforschen. Johann Daniel Major oder Gottlob Siegfried Bayer verbanden Münzstudien und Textexegese, sie lernten Dutzende fremder Sprachen, um die Aufschriften zu entziffern: Arabisch war bald Standard, ungewöhnlich waren nur noch detaillierte Kenntnisse obskurer innerasiatischer Turksprachen oder ausgestorbener Sprachformen. Die europäische Beschäftigung mit dem Fremden explodierte um 1700, die gelehrte Globalisierung war "fremdgeprägt".
Mulsow legt mit seinen bisher zwei Bänden zur "globalen Ideengeschichte" zugleich ein profundes methodisches Programm vor. Globalisierung ist dann ein ideelles Phänomen, wenn sich eine ständige intellektuelle Bezugnahme auf Dinge außerhalb der eigenen Komfortzone aufzeigen lässt. Seine Protagonisten waren schlicht nicht mehr zufrieden damit, China oder Arabien nicht zu behandeln und die anfangs unverständlichen Münzen oder Texte unbearbeitet zu lassen. Das Fremde zu ignorieren, sich nicht damit zu befassen, wurde als intellektuelle Option unmöglich. Darin lag der entscheidende Umschwung um 1700. Diese "Globalisierung im Kopf" war geprägt durch eine Begeisterung für fremde Münzen. Mulsows Protagonisten waren eine "Faszinationsgemeinschaft", und genau darin liegt wohl ihre größte Bedeutung, im Ausleben eines unbändigen Wissenwollens, selbst wenn dieser Wissensdurst dann in der umständlichen Gestalt des späthumanistischen Antiquarianismus daherkam.
Zwar zitiert Mulsow mehrfach Jürgen Osterhammels Formel von der politisch-militärischen "Einkreisung Asiens", doch ist seine Geschichte der "intellektuellen Einkreisung Asiens" dezidiert keine Geschichte intellektueller Herrschaftsansprüche oder gar epistemischer Unterdrückung. Der Wissensdurst europäischer Numismatiker zählt hier nicht zu den "dunklen Seiten der Renaissance" (Walter Mignolo). Vielleicht waren die Thüringischen Lande, aus deren unerschöpflichem Quellenreservoir Mulsows brillanter Rekonstruktion schöpft, weit genug von kolonialem Ränkespiel entfernt, um Schleusinger Gymnasialrektoren oder Jenenser Geschichtsstudenten als Agenten kolonialer Unterdrückung anzusehen - doch schon für die Münzgelehrten in Dänemark oder Russland, die ebenfalls prominent auftauchen, sähe das wohl anders aus, von ihren französischen Korrespondenzpartnern ganz zu schweigen.
Jedenfalls spielt es für Mulsows Idee von intellektueller Globalisierung erst einmal keine Rolle, ob das anwachsende Münzwissen nach heutigem Kenntnisstand "korrekt" war oder nicht. Tatsächlich werden die Engpässe und Grenzen der numismatischen Projekte schnell deutlich: Wie die Kolonialreiche Europas zunächst erst einmal "Imperien der Schwachen" (J. C. Sharman) waren, so war auch das Münzwissen der Globalisierung zunächst nur schwach oder, wie Mulsow sagen würde, "prekär". Es war fehlerbeladen, unvollständig, hochgradig spekulativ, vom Verschwinden bedroht - dabei aber doch grenzüberschreitend und Horizonte öffnend.
Martin Mulsow führt hier ein weiteres Mal bewundernswert vor, was man seine Methode nennen könnte: eine virtuose Verbindung von exemplarischen Fallstudien zu weitestgehend unbekannten Gelehrten mit einer leichthändig geschriebenen großen Erzählung. Dabei beginnt auch die Globalisierungsmoderne an ungewohntem Ort, wie so oft bei Mulsow gewissermaßen auf der "Rückseite" der klassischen Aufklärung. Ihn interessieren nicht die großen Geister, die schillernden Höhepunkte gewöhnlicher Expansionsgeschichten. Stattdessen, so ließe sich resümieren, begann die Globalisierung in thüringischen Landstädtchen, auf dem Schreibtisch Unbekannter, unter dem Schutz klammer Provinzfürsten. MARKUS FRIEDRICH
Martin Mulsow: "Fremdprägung". Münzwissen in Zeiten der Globalisierung.
Matthes & Seitz, Berlin 2023. 413 S.,
Abb., geb., 42,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main