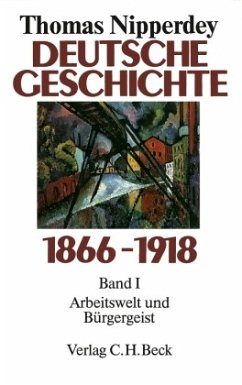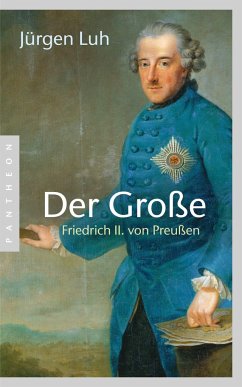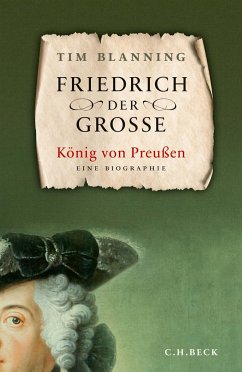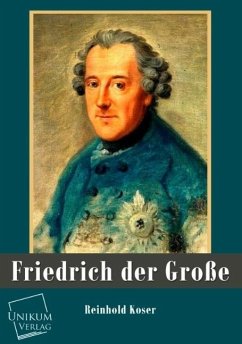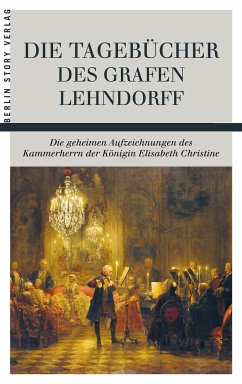Nicht lieferbar
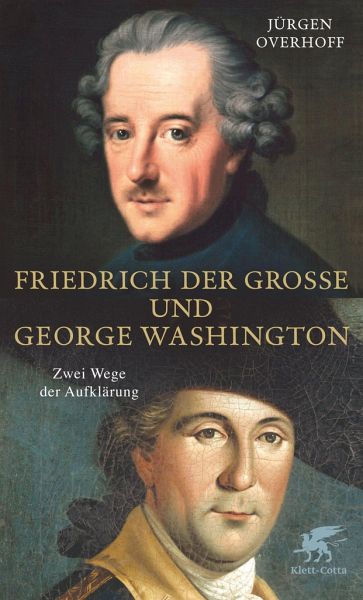
Friedrich der Große und George Washington
Zwei Wege der Aufklärung
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Preußen und die Vereinigten Staaten sind die beiden aus Selbstermächtigung heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend übersah.Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklä...
Preußen und die Vereinigten Staaten sind die beiden aus Selbstermächtigung
heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein
Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem
fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen
Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend
übersah.
Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer
Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des
fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklärter Monarch.
heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein
Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem
fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen
Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend
übersah.
Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer
Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des
fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklärter Monarch.