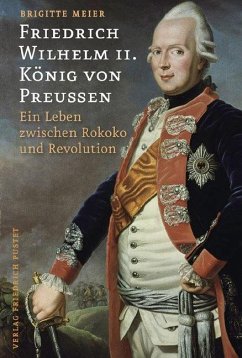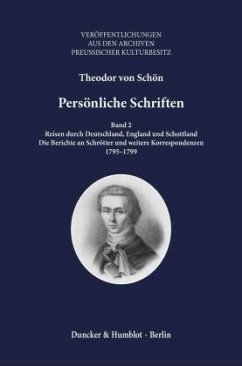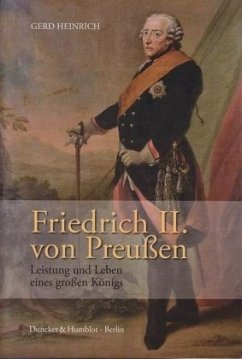Nicht lieferbar

Friedrich II. von Preußen
Ein kulturgeschichtliches Panorama von A bis Z
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Alles, was man zu Friedrich II und Preußen wissen muss Zum 300. Geburtstag des Preußenkönigs am 24. Januar 2012 - vom Mythos zum umfassenden Kompendium: von A wie "Abenteurer","Abort" oder "Armee" bis Z wie "Zeitungen" oder "Zeremoniell". Friedrich II. von PreuPar.en ist als Monarch umstritten - und wird es bleiben. Während seiner 46-jährigen Regierungszeit zu einer berühmten Größe von europäischem Rang und im 19. Jahrhundert zur Nationalikone geworden, kippte das deutsche Monument nach zwei Weltkriegen vom Sockel der Verklärung. Mit der Auflösung der Ost-West-Ideologie nach 1989 ta...
Alles, was man zu Friedrich II und Preußen wissen muss Zum 300. Geburtstag des Preußenkönigs am 24. Januar 2012 - vom Mythos zum umfassenden Kompendium: von A wie "Abenteurer","Abort" oder "Armee" bis Z wie "Zeitungen" oder "Zeremoniell". Friedrich II. von PreuPar.en ist als Monarch umstritten - und wird es bleiben. Während seiner 46-jährigen Regierungszeit zu einer berühmten Größe von europäischem Rang und im 19. Jahrhundert zur Nationalikone geworden, kippte das deutsche Monument nach zwei Weltkriegen vom Sockel der Verklärung. Mit der Auflösung der Ost-West-Ideologie nach 1989 tauchten in den Vereinigten Staaten, in Russland und im antiquarischen Handel verloren geglaubte Quellen aus dem einstigen Geheimen Preußischen Staatsarchiv wie auch Familienarchive pommerscher und preußischer Adliger wieder auf: Dem Historiker Norbert Leithold bot sich also eine neue Grundlage zu aufklärerischer Erforschung des Lebens...