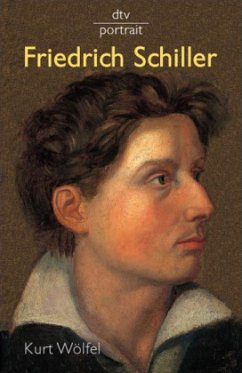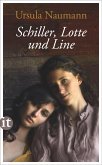"Und am Ende würden wir uns schämen, uns nachsagen zu lassen, dass die Dinge uns formten und nicht wir die Dinge." Friedrich Schiller
Friedrich Schiller (1759 1805) gilt neben Goethe als der deutsche Nationaldichter. Er studierte Jura, dann Medizin und wurde 1780 Regimentsmedikus in Stuttgart. Doch fühlte er sich mehr zum Schriftsteller berufen, begann Dramen und Gedichte zu schreiben und hatte mit der Uraufführung der Räuber großen Erfolg. Das herzogliche Verbot jeglicher poetischer Tätigkeit veranlasste ihn zur Flucht aus Stuttgart.
Schließlich wurde er Professor in Jena, begann einen intensiven Ideenaustausch mit Goethe und prägte mit ihm ab 1799 das "klassische Weimar". Das seiner Dichtung und seinen Schriften zugrunde liegende idealistische Denken wurde später als pathetisch empfunden; heute werden die Werke vielfach neu gedeutet, die Dramen inszenatorisch neu interpretiert.
Friedrich Schiller (1759 1805) gilt neben Goethe als der deutsche Nationaldichter. Er studierte Jura, dann Medizin und wurde 1780 Regimentsmedikus in Stuttgart. Doch fühlte er sich mehr zum Schriftsteller berufen, begann Dramen und Gedichte zu schreiben und hatte mit der Uraufführung der Räuber großen Erfolg. Das herzogliche Verbot jeglicher poetischer Tätigkeit veranlasste ihn zur Flucht aus Stuttgart.
Schließlich wurde er Professor in Jena, begann einen intensiven Ideenaustausch mit Goethe und prägte mit ihm ab 1799 das "klassische Weimar". Das seiner Dichtung und seinen Schriften zugrunde liegende idealistische Denken wurde später als pathetisch empfunden; heute werden die Werke vielfach neu gedeutet, die Dramen inszenatorisch neu interpretiert.

Wider die falsche Schonung: Norbert Oellers bewundert Friedrich Schiller · Von Hans-Jürgen Schings
"Wie lebhaft habe ich bey dieser Gelegenheit erfahren, daß das Vortreffliche eine Macht ist, daß es auf selbstsüchtige Gemüther auch nur als eine Macht wirken kann, daß es, dem Vortrefflichen gegenüber keine Freyheit giebt als die Liebe." So Schiller an den Autor des "Wilhelm Meister". Wohl dem, der sich Schillers Worte zu eigen machen darf, um Schillers Faszinationskraft zu bezeugen. Norbert Oellers hat den Mut und, wie wenige, das Recht dazu. "Freundschaftlich" nennt er sein Verhältnis zu Schiller, "denn er war auf einzigartige Weise ,vortrefflich'". Solche Freundschaft will erworben sein. Seit gut dreißig Jahren arbeitet Oellers nun schon im Weinberg des "Vortrefflichen", leistet er Kärrnerdienste für die große "Nationalausgabe" von Schillers Werken und Briefen. Daß die über fünfzigjährige Geschichte des Unternehmens ihm inzwischen die Regie, die Rolle des alleinigen Herausgebers zugespielt hat, hat seine eigene Folgerichtigkeit, ist die Konsequenz von Verdiensten. Ihm in erster Linie ist es zu verdanken, daß das Flaggschiff der germanistischen Editionsphilologie seinen Kurs erheblich beschleunigt hat und sicher dem Hafen zusteuert (den es noch in diesem Jahrzehnt erreichen wird). Der vorliegende Band enthält auch die ebenso spannend wie nobel erzählte Geschichte dieser Ausgabe und ihrer heiklen Schicksale im geteilten Deutschland. Oellers selbst hat zuletzt (zusammen mit Georg Kurscheidt) den monumentalen Kommentar zu Schillers Lyrik vorgelegt. Die editorische Unsterblichkeit ist ihm gewiß.
Der große Kärrner und Organisator, der die "Mühen der Ebenen" nur eben andeutet, hat jetzt Schiller-Studien aus zwei Jahrzehnten gesammelt. Er erweist sich darin als ebenso großer Werber für seinen Autor. Er wirbt unpathetisch und unaufdringlich. Der hohe, gar schmetternde Ton vergangener Schiller-Verehrung kommt ihm ebensowenig in den Sinn wie das tüftelnde Spekulieren, das sich in Schillers "philosophischer Bude" nach Modernitätserträgen umsieht. Oellers setzt auf Konkretion, grundfeste Sachkenntnis und gradlinige Argumentationsverläufe. Dabei macht er es sich nicht eben leicht. Auch er plädiert für die "Modernität" seines Klassikers. Doch demonstriert er sie just dort, wo die - erschöpfte - zeitgenössische Schiller-Rezeption sie vielleicht am wenigsten suchen würde: an der klassischen Lyrik und an den klassischen Dramen - dort also, wo Kopfschütteln und Verhunzung am weitesten um sich gegriffen haben. Gleich in mehreren Anläufen inspiziert Oellers die Werkstatt Schillers, zeigt er den "Klassiker" bei der alltäglichen Arbeit. So erfährt man, daß Schiller in der Regel fünfzig Verse pro Tag zu schreiben gewohnt war, dazu fünf oder sechs Briefe. Oder auch, daß er, der sich gern als Verächter des Publikums gab und diesem gelegentlich gar mit einer Kriegserklärung drohte, gleichwohl immer wieder auf Einwände und Anregungen eingeht, von Mitteilung, Austausch und Teilnahme abhängig ist, sich umstandslos zu Umarbeitungen entschließt.
Ganz anders steht es natürlich um das Faktum der Krankheit Schillers, das Oellers seinen Studien wie einen Cantus firmus unterlegt. Mit einem Essay über den "kranken Klassiker" beginnt der Band. "Vierzehn Jahre Sterben", so lautet der Befund. Und Oellers holt zu einer rigorosen These aus: "Schiller konnte nur ein Dichter von Rang (eben ein ,klassischer' Dichter) werden, weil er auf entsetzliche Weise ein kranker Mensch war." Da mag es einem schon den Atem verschlagen. Geburt des Klassischen aus dem Geist des Pathologischen, gar aus dem Ressentiment? "Das Klassische nenne ich das Gesunde" - eine große Illusion? Nichts freilich liegt Oellers ferner. Er meint es anders. Die Todesdrohung brachte Schiller zu sich selbst, erst zur Philosophie Kants, dann zum ureigenen Feld der Poesie. Sie sorgte aber auch für die Abkehr von den öffentlichen Angelegenheiten, also auch von der Französischen Revolution, für eine gründliche Einschwärzung des geschichtsphilosophischen Optimismus, der noch die Jenaer Antrittsvorlesung von 1789 befeuert hatte.
So will es die eindringliche Interpretation der "Nänie". Oellers stellt sie gegen den verwegenen Plan einer "Idylle", der die elysisch-utopische Vergötterung des Menschen in der Vermählung des Herakles mit der Hebe darstellen sollte. Die Elegie nimmt diese Schönheitslehre trauernd zurück - "Auch das Schöne muß sterben".
So will es die Abhandlung über den "Wallenstein", eines der Kernstücke des Bandes. Wallenstein geht an sich selbst zugrunde; was in der Tragödie Schicksal heißt und Notwendigkeit, ist in Wahrheit nur Spiel des Zufalls ("Das Zufällige ist das Notwendige"); die teleologische Auszeichnung der Geschichte weicht einem "zufälligen Hin und Her". Hegel behält deshalb zu Recht das letzte Wort, wenn er den "Wallenstein" (mit einem aristotelischen Terminus) "abscheulich" und "entsetzlich" nennt: "das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten; es endigt nicht als eine Theodizee". "Hegels Entsetzen ist nur allzu verständlich", kommentiert Oellers. Verständlich wohl, aber auch angemessen? Hat Hegel nicht den halben Schiller unterschlagen? Wollte Schiller wirklich eine dramatische "Theodizee"? Hatte er nicht jedem "stoffartigen Interesse" den Kampf angesagt, also auch der Produktion positiver oder negativer "Geschichtsbilder"? Gut möglich, daß der "Wallenstein" auch "ein poetisches Dokument der geschichtsphilosophischen Frustration Schillers" darstellt, wie Oellers sagt. Aber ist das schon alles? Noch auf dem Totenbett wollte der "kranke Klassiker" "ein Gespräch anknüpfen, über Stoffe zu Tragödien, über die Art, wie man die höhern Kräfte im Menschen erregen müsse". In die gleiche Kerbe schlägt die berühmte Äußerung gegenüber Süvern: "Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren suchen." Der Abschied vom Schönen, den Oellers sehr wohl wahrnimmt, verbindet sich mit dem Aufstieg des Erhabenen, das er eigentümlich vernachlässigt. Das gilt selbst für die "Maria Stuart" und die "Jungfrau von Orleans", die dann als Panoramen der gräßlichen, alles zermalmenden Geschichte erscheinen. Der "Tell" mag als "Sonderfall" hingehen. Das "Lied von der Glocke" verdankt sich dem Reiz, einem "schon starr gewordenen Geschichtspessimismus poetisch entgegenzuwirken".
Das Zurückweichen vor dem Erhabenen hat Methode, spiegelt es doch die Scheu davor, die "Modernität" des Klassikers durch das Etikett "Idealismus" zu stören. Auch die merkwürdige Karriere des Erhabenen in der gegenwärtigen Ästhetik möchte ja, trotz aller Berufung auf Kant, ohne das "intelligible Ich" auskommen. Kann man einen Schiller ohne Idealismus haben? Oellers, der den Druck dieser Frage durchaus verspürt, hält ihr die Formel von einem "realistischen Idealismus" entgegen. Wenn es dabei um Illusionslosigkeit geht, läßt sich der "Idealist" Schiller in der Tat nicht übertreffen. Seine Theorie des Erhabenen beruht auf solcher Illusionslosigkeit. "Also hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und dem schlaffen verzärtelten Geschmack, der über das ernste Angesicht der Notwendigkeit einen Schleier wirft", heißt es in der Schrift "Über das Erhabene". Und nicht Frustration, sondern Widerstand lautet die Parole. Vielleicht macht das die Größe des leidenden, des "kranken Klassikers" aus, zu dessen Bewunderung die fesselnden und griffigen Studien von Oellers loyal und "freundschaftlich" einladen.
Norbert Oellers: "Friedrich Schiller". Zur Modernität eines Klassikers. Herausgegeben von Michael Hoffmann. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 1996. 383 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Rolf-Bernhard Essig blickt schon ins Jahr 2005 - zum 200. Todestag von Friedrich Schiller - und berichtet in einer umfassenden Sammelrezension, was es Neues gibt am Horizont der Schiller-Literatur. Dabei hat ihn Kurt Wölfels temporeiche und kompakte Darstellung auf der ganzen Linie überzeugt. Wölfel lasse in erster Linie die Quellen sprechen und beweise neben "stilistischer Finesse" einen "frischen Blick auf die Eigenheiten des Klassikers". Letztere - etwa Schillers "notorische Unzuverlässigkeit" oder auch seine "seltsam zufälligen Heiratsideen" - integriere er gewinnbringend in seine Analyse der Werke, die der Rezensent - mit Ausnahme des etwas "langen" Kapitels über die klassischen Dramen - als "differenziert und sehr anregend" lobt. Insgesamt, so der Rezensent, ist Wölfels Bild von Schiller als "genialischem, manchmal kuriosem Enthusiasten", der zunehmend sicherer die "Zentralprobleme der Moderne" beschreibe, von großem Interesse.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Kurt Wölfels reich illustrierte Schiller-Studie ist eine kompakte Lebensbeschreibung, die sich auch als vorzügliche Einführung in Schillers Werk und Gedankenwelt bewährt."
Neues Deutschland
Neues Deutschland