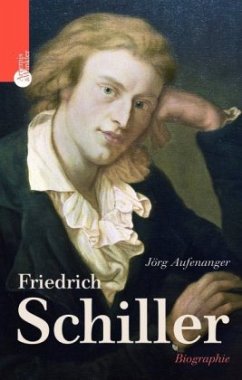Schillers kurzes und unruhevolles Leben ganz aus der Nähe betrachtet: Eine Existenz voller Brüche, erfüllt von fieberhaftem Schaffen, Liebesaffären, heftigem Kollegengezänk und der schwierigen Freundschaft mit Goethe. Jörg Aufenanger trägt die dicke Ölschicht der Heldenverehrung ab und fördert einen fragilen Menschen zutage, der in einer Zeit des sozialen, intellektuellen und politischen Umbruchs lebte.

Gib der Welt die Richtung zum Guten: Neue Bücher zu Schillers Leben / Von Friedmar Apel
Im neudeutschen Schulunterricht gehören Schillers Werke nicht mehr zur Pflichtlektüre, was nicht jeder bedauert, dem einst "Die Bürgschaft" Tugend und Anstand beibringen sollte. Daß man von Schiller allerlei lernen kann, zeigt sich für Johann Prossliner aber nach wie vor in den geflügelten Worten, die der Dichter den Deutschen "geschenkt" habe. Im Nachwort zu seinem Lexikon der Schiller-Zitate erklärt Prossliner das "Geheimnis ihrer Allgegenwart" aus Schillers Welthaltigkeit und seiner Fähigkeit zu sprachlich pointierten Antithesen. Tatsächlich läßt sich bei Schiller zu fast jeder Maxime auch ihr Gegenteil finden, was der Erfahrung der modernen Welt immer besser zu entsprechen scheint.
Für Christiana Engelmann und Claudia Kaiser ist der "lebensfrohe und energiegeladene" Dichter so "spannend" wie je schon; jedoch muß er zuvor "aus der Gruft geholt und zum Leben erweckt" werden. Allerdings könne man sich ihn nicht ohne weiteres als Klassenkameraden von heute vorstellen. Obwohl er reichlich über "soft skills" verfügte, würden ihn seine Mitschüler "wahrscheinlich peinlich finden", irgendwie uncool eben. Aber er sei "immer auf der Suche nach spannenden Themen" gewesen, und in seinen Figuren könnten sich auch heutige Jugendliche wiederfinden.
Franz kann es an starken Worten "locker mit Karl aufnehmen", jedoch hat sein "Fehlstart" in der Kindheit seine Charakterentwicklung negativ beeinflußt. So kann er einem am Ende "fast leid tun", zumal in den "Räubern" leider keine Mutter vorkommt, die "eingreifen könnte". Luise und Ferdinand aus "Kabale und Liebe" sind aber "ein ganz modernes Paar", was ihnen allerdings damals ziemlich Stress machte. Ganz anders bei Schillers zu Hause: "Zugegeben, es war alles ziemlich traditionell", trotzdem "lief alles wunderbar". Schillers waren eine "rundum nette Familie". Bei solcher Didaktik steht zu befürchten, daß die Schüler für ihre Lektüre auf die altbekannte Kurzfassung von "Der Taucher" zurückgreifen: "Gluck, gluck, weg war er."
Jörg Aufenanger hat sich dagegen nicht erschlossen, daß Schiller ein netter und fröhlicher Typ war. Sein Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen sei vielmehr unter größten Schwierigkeiten erfolgt. Schiller habe unter einer "Unfähigkeit zum Glücklichsein" gelitten, immer wieder habe es Phasen der inneren Krisen, der seelischen Einsamkeit und Verzweiflung gegeben. Seine kränkliche Konstitution führt Aufenanger auch auf "das wüste Leben seiner Jugend" zurück. So schimpft der Biograph öfter mit ihm: auch später habe er seinen Körper "durch Nachtarbeit, Alkohol, Medikamente und Drogen aller Art" systematisch ruiniert. Wie die Alkaloide Ersatz des Lebensgenusses gewesen seien, so die Dichtung "Arbeit und verhindertes Leben" und Anschreiben gegen den Tod. So erscheint Schiller auch in Aufenangers Portrait noch als ein heroischer Mensch, und sei es auch vor allem im Kampf gegen seine eigenen Schwächen. Aufenanger übertreibt vielleicht die pathologischen Befunde, seine Darstellung weist aber nachdrücklich darauf hin, daß die Literatur keine Sphäre allgemeiner Nettigkeit ist. Vor Nachahmung durch heutige Jugendliche sind daher Arzt oder Apotheker zu konsultieren.
Eva Gesine Baur legt in ihrer Darstellung des Lebens der Charlotte Schiller nahe, daß Friedrich ohne sie den Kampf schon viel früher verloren hätte. Allerdings möchte die Biographin das Klischee der züchtig waltenden "perfekten Ehefrau" aufbrechen. Es spricht für ihre Redlichkeit und ihre umfassende Kenntnis der Briefwechsel im Umkreis der Schillers, daß ihr das nicht ganz gelingt. Die Inbrunst, mit der Charlotte ihre Kinder aufzog, gehe sogar über zeittypische Erziehungsideale, zumal des Adels, weit hinaus. Die oft verspottete idealisierende Darstellung der Hausfrau bei Schiller hat ihr reales Pendant in seiner Liebsten.
Die personifizierte "Dezenz", wie er zu spotten pflegte, besaß zwar Bildung, Scharfblick und Urteilsfähigkeit weit über die häusliche Sphäre hinaus, aber ihre Gabe der Einfühlung zeigt sich auch für die kritische Biographin vor allem in der Fürsorge für die Familie. Das überlieferte Bild vom hingebungsvoll spielenden Kindervater Schiller wird dabei stark in Frage gestellt. Trotz unzweifelhafter Liebe zu seinen Kindern sei er als Vater "unzuverlässig und unberechenbar" gewesen, sein "egomaner Lebensrhythmus", in dem Saufrunden und Herrenabende mit Goethe oft Vorrang vor den Familienansprüchen gehabt hätten, vor allem aber seine Arbeitswut, hätten nicht selten die Kinder büßen müssen. Dementiert wird auch die Überlieferung, Charlotte habe für Schillers Erhebung in den Adelsstand gesorgt: "Schiller selbst ist es, der sich um die Aufnahme am Hof bemüht." Ähnlich sei seine Eitelkeit schon in der "Gier auf einen Doktortitel" hervorgetreten.
Das "tägliche Chaos" im Hause Schiller wurde jedenfalls allein von der Ehefrau gebändigt. Dennoch wird Charlotte Schiller nicht als Opfer eines egoistischen und hypochondrischen Mannes dargestellt. Mit Schiller glücklich zu sein sei offenbar nicht schwer gewesen. Aufregend, wie Eva Gesine Baur meint, ist ihre Darstellung einer ungewöhnlich Liebesfähigen eher nicht, aber doch ein sehr anrührender Beitrag zu einem differenzierteren Bild der Lebensumstände des Dichters, seiner Familie und ihrer nicht unproblematischen Stellung in der Weimarer Gesellschaft der Zeit.
In dem perspektivenreichen Nachwort zu der sehr schön illustrierten, so elegant wie lebendig erzählten Schiller-Biographie von Marie Haller-Nevermann weist Walter Müller-Seidel noch einmal darauf hin, "daß die Moderne mitten in der Klassik" beginnt. Schiller sei der "Archetypus des modernen Menschen", der an den Verhältnissen und zugleich an der Wunde des Intellekts, des Zwangs zur Reflexion leide, ohne an eine Grenze zu gelangen. Als Rettendes aber habe er die "Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst" gedacht.
Wie schon in der Darstellung von Peter-André Alt (München 2000) erscheint Friedrich Schiller auch bei Marie Haller-Nevermann als chronisch überarbeiteter Leistungsethiker, dessen rastlose Schreibwut als Ankämpfen gegen Vereinzelung etwas verzweifelt Gewaltsames gehabt habe. Daß Schiller zum "ideenfruchtbarsten Kopf" der Epoche (Humboldt) werden konnte, erklärt die Biographin aus dem Zusammenwirken von Aufsteigermentalität, schwacher körperlicher Konstitution und den Zufällen eines Lebenswegs, der die Innerlichkeit über die äußeren Ereignisse erhob.
Schillers Bedürfnis nach Stimulanzien, Tabak, alkoholischen Getränken aller Art, Kaffee und Opiaten, erscheint als Symptom eines schmerzhaft empfundenen Erfahrungshungers, der aufgrund einer "unversöhnlichen Entzweiung mit der Tat" ungestillt blieb. Gerade diese kritische Disposition aber habe Schiller den distanzierenden Blick für das Verhältnis von Machtstrukturen und Denkstrukturen gegeben. Seine Ästhetik des Widerstands gegen zweckrationale Wahrnehmungslenkung steht dabei in einem prekären Verhältnis zu der Einsicht, daß Gutsein der Luxus derer ist, die nicht politisch handeln müssen.
Erfahrungsarmut und Handlungshemmung aber habe Schiller durch Selbstbeobachtung in der Tradition des schwäbischen Pietismus, vor allem aber als Genie der Freundschaft und Liebe und des Gesprächs ausgeglichen. Auf den Weimarer Festen tanzte er nicht, sondern redete. Was der im Grunde scheue und bescheidene Mensch in der Außenwelt nicht wahrnehmen konnte, fiel ihm als Bildungserlebnis in der lebendigen Begegnung wie in Korrespondenz und Lektüre zu.
Gerade seine Distanz zur Tat, die nicht erst eine Folge des Terrors der Französischen Revolution gewesen sei, habe ihm den Blick eines Tragikers gegeben, der wie unwillkürlich den "Leidensweg jeder Idee", ihr Scheitern an der äußeren Wirklichkeit erkannt habe. Die Idee der Freiheit kann dabei je nur als gestalteter Widerspruch sinnlich erscheinen, daher auch Schillers außerordentliche Wertschätzung der Musik als Gestalt jenseits von Bedeutungen. Dem Vortrefflichen gegenüber aber, so Schiller 1796 an Goethe, und so das Motto der liebenswürdigen Darstellung von Marie Haller-Nevermann, gibt es keine Freiheit als die Liebe.
Johann Prossliner: "Kleines Lexikon der Schiller-Zitate". Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004. 256 S., br., 6,95 [Euro].
Christiana Engelmann / Claudia Kaiser: "Möglichst Schiller". Ein Lesebuch. Reihe Hanser, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004. 392 S., br., 7,50 [Euro].
Jörg Aufenanger: "Friedrich Schiller". Biographie. Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf und Zürich 2004. 328 S., geb., 24,90 [Euro].
Eva Gesine Baur: "Mein Geschöpf mußt du sein". Das Leben der Charlotte Schiller. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2004. 432 S., geb., 24,95 [Euro].
Marie Haller-Nevermann: "Friedrich Schiller. Ich kann nicht Fürstendiener sein". Eine Biographie. Aufbau Verlag, Berlin 2004. 304 S. geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Hanno Helbling ist keineswegs einverstanden mit Jörg Aufenangers Schiller-Biografie. Er ist eher pikiert. Den lässig-modernen Ton, den Aufenanger anschlägt, empfindet er als schnoddrig, der Verzicht auf Anmerkungen wird kopfschüttelnd vermerkt, auch fehlende Kenntnis des Gegenstands - es geht um Schillers und Goethes Brauch, sich auch als enge Freunde noch zu siezen - moniert der Rezensent. Gelten lässt er einzig das Register.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH