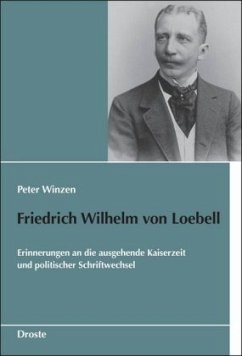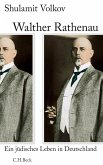Friedrich Wilhelm von Loebell (1855-1931) war eine zentrale politische Figur der spätwilhelminischen Ära, als Chef der Reichskanzlei unter dem Reichskanzler Bernhard von Bülow (1904-1909) wie auch als Preußischer Innenminister (1914-1917) in der Regierung des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg, und kann als der eigentliche Schöpfer der Bülowschen liberalkonservativen Blockpolitik gelten. Geprägt von einem rückwärtsgewandten aristokratisch-preußischen Weltbild und antisozialistischen Ressentiments, trug er während der Vorkriegszeit und der ersten Kriegsjahre dazu bei, eine moderne innenpolitische Entwicklung in Deutschland zu verhindern. Diesen politischen Kurs setzte er auch in der Weimarer Republik fort, indem er als Präsident des Reichsbürgerrats und des Reichsblocks die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten in die Wege leitete.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Friedrich Wilhelm von Loebell: Chef der Reichskanzlei und auch von 1914 bis 1917 Innenminister Preußens
Das "Hamburger Fremdenblatt" übte harsche Kritik, als Friedrich Wilhelm von Loebell 1904 Chef der Reichskanzlei wurde. Reichskanzler Bernhard von Bülow habe damit die Reaktion gestärkt. Die Regierung erstrebe jetzt "im Geheimen schon/ die ,Meinung zu organisieren',/ Zum Schutze von Altar und Thron/ muss jederzeit das Volk parieren". Tatsächlich war mit Loebell ein Konservativer reinsten Wassers in ein Spitzenamt des wilhelminischen Deutschland eingerückt, der zwischen 1914 und 1917 sogar als preußischer Innenminister amtierte.
Dank der von Peter Winzen besorgten Edition liegt jetzt ein stattlicher Teil der politischen Korrespondenz Loebells vor. Sie ist in der Kommentierung vorzüglich geraten, nur erschwert ein lückenhaftes Register die Nutzung. Glücklicherweise hat der Herausgeber den Fokus nicht auf die bekannten Dokumente, sondern halbamtliches Schriftgut gelegt. Es ist streckenweise eine dramatische Lektüre, die insbesondere die Verhandlungen im Kontext von Blockpolitik, Polen-Frage, Finanzreform, Marokko-Krisen und Rüstung nachvollziehbar macht. Als besonders explosives Thema sollte sich während des Ersten Weltkrieges die preußische Wahlrechtsfrage erweisen.
Loebells politisches Handeln war an drei Grundprinzipien orientiert, die zum Wesenskern des deutschen Konservatismus der Epoche gehörten. Er trat ein für die Stärkung des Reiches, den Schutz von Monarchie und Staat, sowie - eng damit verbunden - die Bekämpfung der Sozialdemokratie. Der SPD war er in besonderer Abneigung verbunden. Die "vaterlandslosen" Sozialdemokraten arbeiteten gemäß Loebells dichotomischer Weltsicht an der Zersetzung der Monarchie und bedrohten damit das, was vergangene Generationen mühsam erworben hatten. Das Erreichte sollte stattdessen zu imperialer Größe emporwachsen. Während der Marokko-Krise 1911 trat er für eine große Heeres- und Marinevorlage ein, zwei Jahre später betonte er, dass die "ernste Zeit" Männer nötig mache, die "den Willen zur Tat" besäßen und eine Politik der nationalen Stärke verfolgten. Im Ersten Weltkrieg warb Loebell für einen Annexionsfrieden.
Auf den ersten Blick scheint Loebells Biographie die Sonderwegsthese zu bestätigen, wonach die modernitätsfeindlichen Eliten das Kaiserreich auf einer undemokratischen Bahn festhielten und jeglichen Wandel verhinderten. Tatsächlich jedoch reicht dieses Bild nicht aus, um Zeit und Person angemessen zu erfassen. Die Korrespondenz macht vielmehr deutlich, dass eine konservative Politik auch im wilhelminischen Deutschland nicht oktroyiert werden konnte, sondern ausgehandelt werden musste. Sie trug - ständig von einer kritischen Presse begleitet - immer auch die Möglichkeit des Scheiterns in sich. Trotz aller kraftmeierischen Rhetorik verlief Loebells Rüstungsinitiative zunächst im Sande, ebenso wie zuvor seine Forderung nach einer Sondergesetzgebung gegen sozialdemokratische Demonstrationen. Stattdessen plädierte man 1906 im Preußischen Staatsministerium dafür, nur im Rahmen bestehender Gesetze einzuschreiten, um innenpolitische Konflikte nicht noch zu verschärfen.
Loebell empfand die Epoche der Hochmoderne als eine Zeit krisenhafter Zuspitzung innen- und außenpolitischer Konflikte und sah mit Sorge, wie die "Menge" auf die politische Bühne drängte. Das rief erhebliche Unsicherheiten hervor, die er mit den genannten Abwehrmaßnahmen zu bewältigen trachtete. Dabei blieb er gleichwohl nicht stehen, sondern bezog das Faktum der politisierten und fragmentierten Gesellschaft - wenn auch widerstrebend - in seine Tätigkeit ein. Besonders deutlich wird das im Umgang mit der Presse, die er als politisches Instrument nutzte. Auch seine Sozial- und Wirtschaftspolitik entzieht sich einer einseitigen Beschreibung als rückwärtsgewandt oder reformfeindlich. Vielmehr erwies er sich hier als Konservativer in der Tradition von Edmund Burke. Dieser hatte 1790 in seinen Betrachtungen zur Französischen Revolution festgehalten, dass die permanente Erneuerung des Staates notwendig sei, um ihn zu erhalten und Umstürze zu verhindern. Zu einem ähnlichen Schluss kam 1910 auch der demissionierte Bülow, nachdem er Hippolyte Taines Darstellung der Revolution gelesen hatte. Er schrieb an Loebell, die "Verbohrtheit der Hofleute" habe eine Konstitutionalisierung des Ancien Régime verhindert, die doch "der Entwicklung eine andere Wendung" gegeben hätte.
Vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges klingen diese Worte beinahe prophetisch, und nun zeigten sich auch die Grenzen von Loebells Anpassungsfähigkeit. Trotz des Burgfriedens, in dessen Zuge politische Kontroversen geächtet wurden, geriet die seit langem schwebende Frage des preußischen Dreiklassenwahlrechts auf die Agenda. Jene Bürger, die ein Drittel des Steueraufkommens erbrachten, durften ein Drittel des Abgeordnetenhauses bestimmen. Es wies deutliche Unterschiede zum gleichen Reichstagswahlrecht auf und wurde als ungeheure Benachteiligung der unteren Bevölkerungsteile verurteilt.
Die Wahlrechtsdebatte zeigte, dass die von Loebell kritisch beäugten Zeittendenzen durch den Krieg erheblich beschleunigt wurden. 1917 notierte er, dass "in dieser Epoche des gewaltigen Geschehens nur gilt, wer dem Strom der Zeit das Bett gräbt. Wer jetzt abwartet, vor den springen die Radikalen". Es erscheint paradox, dass sich Loebell dennoch eher damit befasste, diesem Strom Barrieren entgegenzustemmen. Als Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg 1917 die Reform initiierte, reagierte Loebell verständnislos. Der Kanzler ließe sich "in seiner weltfremden Lebensauffassung leicht etwas weit treiben. Das Reichstagswahlrecht für Preußen! Eine Unmöglichkeit, die unabsehbare Folgen haben würde." Hier bewies Bethmann Weitsicht. Er schrieb Loebell, dass nicht zuletzt die Demokratisierungspropaganda der Alliierten diesen Schritt notwendig mache und er nicht verwundert wäre, sollten sie dereinst erklären, sie seien "jederzeit zum Friedensschluss mit dem deutschen Volke, nicht aber mit der Hohenzollerndynastie bereit". Genau das proklamierte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson im Oktober 1918. Da waren bereits beide längst über die Reformfrage gestürzt.
Loebell fand sich 1917 erst nach langem Zögern bereit, einen Wahlmodus vorzuschlagen, die Stimmen nach Bildung, Kinderzahl, Lebensalter und Vermögen staffelte. So sollte nicht die "Masse", sondern der "Tüchtige" Einfluss erlangen. Diesem unzeitgemäßen Pluralwahlrecht, dem eine starke erzieherische Komponente innewohnte, fehlte die Unterstützung. In der Folge beteiligte sich Loebell an der Fronde gegen Bethmann, die diesen im Sommer 1917 zu Fall brachte. Um den Druck auf den Kanzler zu erhöhen, hatte auch Loebell seinen Rücktritt erklärt. Es zeugt von einem erstaunlichen Opportunismus und einem Schuss Naivität, dass er nur kurze Zeit später um Wiedereinsetzung in das Amt des Innenministers bat - verbunden mit der Versicherung, nun das gleiche Wahlrecht durchzusetzen. Ein Ansinnen, das der neue Kanzler Georg Michaelis ablehnte.
Die Edition vertieft das Bild der Politik des Kaiserreichs, indem sie Denkweisen und Machtstellung der wilhelminischen Eliten erschließbar macht. Zugleich zeigt sie auf, wie sozialer Wandel und Fundamentalpolitisierung den deutlichen obrigkeitsstaatlichen Tendenzen des Kaiserreiches Zügel anlegten. Loebells Wirken ist - wie die Geschichte des Kaiserreiches insgesamt - von Widersprüchen und Ambivalenzen gekennzeichnet. Schlussendlich beschleunigte er mit seiner Politik den Untergang dessen, was er bewahren wollte, ohne die Entwicklungen jemals wirklich in der Hand gehabt zu haben.
CHRISTOPH NÜBEL
Peter Winzen (Herausgeber): Friedrich Wilhelm von Loebell. Erinnerungen an die ausgehende Kaiserzeit und politischer Schriftwechsel. Droste Verlag, Düsseldorf 2016. 1255 S., 89,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main