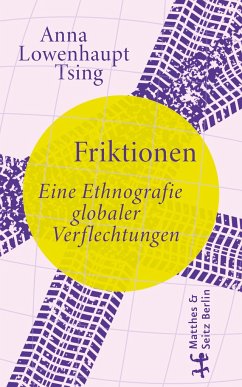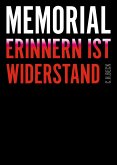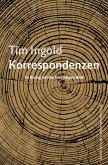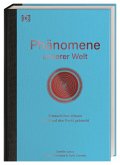Der Regenwald im Meratusgebirge auf Borneo verändert seit 1970 grundlegend seine Gestalt: Holz und die natürlichen Ressourcen seiner Böden werden auf dem internationalen Markt verkauft, um Schulden zu begleichen und sich zu bereichern. Nationale und globale, individuelle und universelle Interessen überlagern sich: Korrupte Provinzbehörden machen gemeinsame Sache mit japanischen Investoren, javanesische Einwanderer verdrängen autochthone Waldbewohner. Doch auch zum Schutz des Waldes formieren sich breite Allianzen, Studenten aus der Hauptstadt treffen auf engagierte Dorfbewohner, internationale Aktivisten und Naturliebhaber. In einer atemberaubenden Szenenfolge zwischen Reportage, Feldforschungsbericht und kulturtheoretischen Überlegungen begleitet Anna Lowenhaupt Tsing die Geschehnisse und entwickelt eine einzigartige Ethnografie der Friktionen.
In Borneo, an einem Ort, der beispielhaft ist für eine globalisierte Welt, offenbart sich, dass aus vielfältigen und widersprüchlichen sozialen Interaktionen, die unsere heutigen Lebensrealitäten ausmachen, ebenso zukunftsträchtige wie monströse Kulturformen entstehen können.
In Borneo, an einem Ort, der beispielhaft ist für eine globalisierte Welt, offenbart sich, dass aus vielfältigen und widersprüchlichen sozialen Interaktionen, die unsere heutigen Lebensrealitäten ausmachen, ebenso zukunftsträchtige wie monströse Kulturformen entstehen können.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Renate Kraft schätzt Anna Lowenhaupt Tsings Buch, in dem "ethnografische Detailbeobachtung und Theoriebildung" auf für sie überzeugende Weise zusammenlaufen: Es geht um den konkreten Fall eines erfolgreichen Protests gegen die Abholzung des Regenwalds in Borneo um die Jahrtausendwende. Ausgehend von diesem Fall entwickelt die amerikanische Anthropologin eine postkolonialistisch ausgerichtete Theorie, die sich um sogenannte "Friktionen" herum organisiert: also um Prozesse der Reibung und des Widerstands, erklärt Kraft. Wie Tsing aus ihrer Expertinnenposition - sie selbst hat sehr enge Beziehungen zu verschiedenen Gruppen von Indigenen, insbesondere zu den Meratus-Dayak - über deren Weise der Waldbewirtschaftung aufklärt und sich dafür einsetzt, findet Kraft lobenswert und vor allem "begründet". Sie lernt viel über die Vergangenheit der Region, über die Vorteile nationaler Plattformen oder über "reisendes Wissen" und lobt die auch mal "humorvoll-kritische, aber immer respektvolle" Haltung Tsings. Ein wichtiges und hoffnungsvolles Buch, schließt Kraft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH