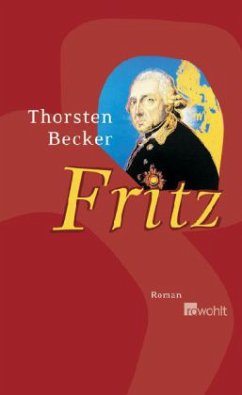Thorsten Becker belebt den historischen Roman neu, mit einem weit gespannten Epos über Friedrich den Großen, den Alten Fritz, als Staatsmann und Feldherr Schöpfer von Preußens Gloria und verantwortlich für eine Konstellation der europäischen Großmächte, die zwei Jahrhunderte später in den Schrecken zweier Weltkriege mündete. Schon Thomas und Heinrich Mann planten einen Roman über diese für das deutsche Schicksal so entscheidende Figur - und Thorsten Becker schlüpft in die Haut der Brüder, plottet und denkt in ihrem Namen, dass es nur so raucht über den Schlachtfeldern der großen preußischen Expansion. Auch Friedrich selbst wird scharf umrissen: sein aufgeklärter Despotismus, sein Kunstsinn, seine versteckte Homosexualität, sein Franzosentum und sein literarischer Esprit. Mit frischer Ironie und politischer Klarsicht befreit Becker den Alten Fritz vom Ruch des Abgeschmackten, Deutsch-heroischen, der ihm seit den kitschigen Verfilmungen seines Lebens aus den dreißiger und fünfziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts anhaftet. Er stellt ihn in neuem Gewande vor uns: als begnadeten Staatslenker, als Vorreiter der politischen Moderne und, nicht zuletzt, als schwaches, zutiefst einsames Individuum.
Jahren des vergangenen Jahrhunderts anhaftet. Er stellt ihn in neuem Gewande vor uns: als begnadeten Staatslenker, als Vorreiter der politischen Moderne und, nicht zuletzt, als schwaches, zutiefst einsames Individuum.

Einen Roman über Friedrich den Großen, verfaßt vom Brüderpaar Heinrich und Thomas Mann, hat es nie gegeben. Aber jetzt gibt es ihn doch: Mit Verve und Schneid hat Thorsten Becker die Geschichte dieses ungeschriebenen Buches für seinen neuen Roman "Fritz" erfunden.
Von Andreas Kilb
Dieses Buch ist ein toller Streich: ein historischer Roman, der von der Entstehung eines historischen Romans über Friedrich den Großen erzählt; eine Geschichte der Geschichte, ein Buch über Preußen und Deutschland! Und in den Hauptrollen: die Brüder Mann, Heinrich und Thomas, das Doppelgestirn der deutschen Literatur! Ist Thorsten Becker wirklich der erste Autor, dem diese Idee zuflog? Er ist es. Und mit demselben Schneid, den er schon in seinen früheren Büchern gezeigt hat, geht er auch in "Fritz" auf sein Thema los.
Heinrich Mann, soviel wissen wir, ist am 12. März 1950 in Santa Monica gestorben, mitten in den Vorbereitungen zur Abreise in die damalige DDR. Bei Becker aber lebt er weiter, fährt über den Atlantik nach Berlin, wo er zum Akademiepräsidenten ernannt worden ist, und schreibt von unterwegs an seinen Bruder in Kalifornien. "Gib acht, lieber Tommy: Wollen wir nicht am Ende eines langen, langen Weges unsere schwindenden Kräfte zusammenpacken und dem, was wir in früher Jugend geträumt, Wirklichkeit geben? Ahnst Du, wovon ich spreche? Laß uns gemeinsam einen Roman schreiben. Den Friedrich-Roman."
Diesen Friedrich-Roman hat es in Wirklichkeit nicht gegeben, aber es hätte ihn geben können. Thomas Mann hat 1915 einen berühmt-berüchtigten Essay über "Friedrich und die große Koalition" verfaßt, Heinrich hinterließ bei seinem Tod ein szenisches Fragment unter dem Titel "Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen". Beides weiß Becker, dessen vorletzter Roman "Der Untertan steigt auf den Zauberberg" den Betriebsgeheimnissen der Familie Mann hinterherphantasierte, natürlich genau. Deshalb diktiert er seinen beiden Helden nicht nur die ersten acht Kapitel eines gemeinschaftlichen Friedrich-Buchs in die Feder, sondern streut auch Bruchstücke aus einer in Knittelversen geschriebenen Familientragödie namens "Katte" ein. Deren Verfasser bleibt absichtsvoll ungenannt; Beckers fiktiver Thomas Mann sucht ihn bei "Mackie Messer und seiner Bande", also im Umkreis Brechts.
Seit das Potsdamer Hans-Otto-Theater im letzten September mit eben jenem "Katte" wiedereröffnet wurde, ist der Schöpfer des Versdramas über die grausame Jugend des Kronprinzen Friedrich aber bekannt: Es ist Thorsten Becker. So gibt es in "Fritz" buchstäblich nichts, was nicht von Becker stammt. Die vielen literarisch-historischen Spiegel, die in dieser Geschichte hintereinandergehängt sind, zeigen am Ende immer das Bild des Autors selbst. Sie zeigen ihn als Kenner der Weltlage um 1950, als fleißigen Rechercheur preußisch-fritzischer Kuriosa, als furchtlosen Stimmenimitator Thomas und Heinrich Manns und als tapferen, aber holprigen Knittelreimer ("Was ich noch tun kann, bis der Vorhang fällt, / Nicht in meine Wahl war, ist das gestellt"). Was die Spiegel nicht zeigen und auch nicht zeigen wollen, ist ein stichhaltiges Zeitbild, sei es aus dem Barock oder dem Kalten Krieg. Flott, aber im ganzen ziellos dreht sich dieser Roman immer um die eigene Achse, bis seinem kunstreichen Spiel die Puste ausgeht.
Das dauert eine ganze Weile. Beinahe dreihundert Seiten lang fährt man nicht schlecht mit Beckers briefwechselnden Brüdern, die spekulierend durchs achtzehnte Jahrhundert wandeln, ihre altbekannte Rivalität in der stillen Feindschaft zwischen König Friedrich und dem in Rheinsberg residierenden Prinzen Heinrich abbilden und nebenbei den neusten Klatsch aus Pacific Palisades und Hohenschönhausen mitteilen. Auch der Protagonist des Romans im Roman, ein gewisser Gottlust Hamann, ist geschickt ausgewählt: Als Schauspieler und Katte-Darsteller gibt er seinen beiden Erfindern Gelegenheit, des Preußenkönigs wunde Seele zu ergründen, während er als Flüchtling aus dem feindlichen Sachsen genügenden Anlaß bietet, die Gemengelage in Mitteleuropa um 1778 auszuleuchten. Der im selben Jahr ausbrechende Bayerische Erbfolgekrieg, wegen der miesen Verpflegungslage auch Kartoffelkrieg genannt, ist der perspektivische Fluchtpunkt des Friedrich-Romans, so, wie der Aufstand vom 17. Juni 1953 der Fluchtpunkt von "Fritz" ist. Beide Ereignisse waren gewissermaßen innerdeutsche Auseinandersetzungen, und beide gipfelten in der Wiederherstellung der alten Ordnung. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten.
Und es endet auch, ungefähr nach zwei Dritteln der Strecke, die Freude des Lesers an Thorsten Beckers Roman. Nicht daß d'Alemberts Bericht über den Tod Voltaires, den Becker ausführlich zitiert, oder das Communiqué des österreichischen Gesandten in Berlin, eines Grafen Kobenzl, die Lektüre nicht wert wären; aber man spürt doch, daß der Autor von "Fritz" allmählich nach einem Ausweg aus seiner eigenen literarischen Versuchsanordnung tastet, nach einer möglichst nahen, nur irgendwie gangbaren Tür ins Freie. Weil er selbst nicht reden kann, schickt er "Tommy" vor, der über das Recht alternder Schriftsteller bramarbasiert, "dies oder jenes als Fragment der Nachwelt zu überliefern", und zur Sicherheit wird aus Kalifornien noch ein Adorno-Zitat nachgereicht, das ins selbe Horn stößt.
Auch Heinrich Mann, der inzwischen eine Affäre mit Ruth Berlau angefangen hat, verliert zunehmend die Lust am Schreiben, und so bleibt das Friedrich-Projekt im achten Kapitel stecken. Statt dessen folgt ein heftig allegorisierender Epilog, in dem Brecht, Erika Mann, Ruth Berlau und der greise Heinrich den Juni-Aufstand von 1953 als revolutionäre Schmierentheatertruppe begleiten. Das Schlußtableau, in dem die vier zusammen mit dem ins Friedrich-Kostüm geschlüpften Gottlust einen russischen Panzer angreifen, wirkt wie eines jener "eingefrorenen" Bilder, mit denen Filme aufhören, deren Regisseure keine richtige Auflösung gefunden haben.
Dieses Buch sollte ein toller Streich werden. Es ist aber nur ein flacher, halber geworden, und vielleicht liegt das noch nicht einmal hauptsächlich an Thorsten Becker, der seinen Aufenthalt als Stadtschreiber im Preußenschloß Rheinsberg mit "Fritz" redlich bezahlt hat. Denn der Popanz, gegen den er seinen Streich führt, der historische Roman als literarische Form, hat in den vergangenen fünfzig Jahren an Auflage ebenso zugelegt wie an Bedeutung verloren. Man liest ihn nicht mehr, wie zu Zeiten Feuchtwangers, als Spiegel der Gegenwart, sondern schlürft und futtert ihn zur Erholung vom Bildschirm-Alltag.
Ob Geschichtsromane nur eine Unterabteilung, eine "daneben laufende Abart" des Romans überhaupt seien, fragt sich Beckers Thomas Mann einmal sorgenvoll. Kann sein, daß es so ist, aber ohne solche Skrupel schreibt man dennoch besser. So beweist auch Becker mit seinem "Fritz", daß er dann am besten ist, wenn er aufs Reflektieren verzichtet und sich an das hält, was seines Amtes ist: ans Erzählen.
Thorsten Becker: "Fritz". Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006. 399 S., gb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zufrieden zeigt sich Andreas Kilb mit diesem Roman Thorsten Beckers, der sich ausmalt, wie die Brüder Thomas und Heinrich Mann nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen einen historischen Roman über Friedrich den Großen schreiben. Anfänglich von die Lektüre vollauf begeistert, hat sich bei nach etwa zwei Dritteln des Romans eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Gefallen hat ihm der Schneid und der erzählerische Schwung, mit dem Becker seinen historischen, vielfach in sich gespiegelten Roman angeht. Er bescheinigt ihm, die Weltlage um 1950 bestens zu kennen und zahlreiche preußisch-fritzige Kuriosa einzubringen. Außerdem schätzt er ihn als "furchtlosen Stimmenimitator Thomas und Heinrich Manns" und als "tapferen, aber holprigen Knittelreimer". Allerdings kann ihn das Werk dramaturgisch nicht überzeugen, dreht sich die Geschichte doch irgendwann nur noch ziellos im Kreis.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH