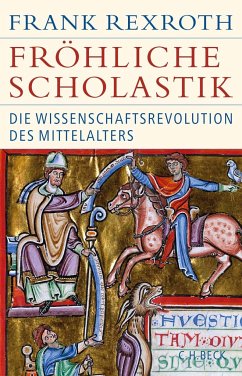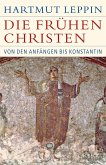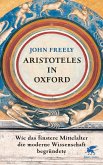Im mittelalterlichen Europa ereignete sich eine Revolution, die bis heute unser Leben bestimmt: Gelehrte befreiten sich von den Glaubensgewissheiten der Vergangenheit und gingen ihren eigenen Fragen nach. Frank Rexroth lässt in seinem Buch so anschaulich und quellennah wie nie zuvor das Leben der mittelalterlichen Gelehrten, ihre neuartigen Schulen, ihre Emotionen, Ideen und Entdeckungen lebendig werden und zeigt, wie schließlich das entstand, was wir heute Wissenschaft nennen.
Als Peter Abaelard im 12. Jahrhundert den Vorrang der Vernunft in allen Fragen verkündete (und noch dazu ein Verhältnis mit seiner Schülerin Heloise begann), war das ein Skandal. Doch er war nicht der Einzige, der eigensinnig sein Wissen selbst erforschen und sein Leben dem neuen Projekt des «scholastischen» Wissens verschreiben wollte. Frank Rexroth erzählt, wie sich Schüler zu neuen Gruppen und Schulen zusammenfanden, beobachtet ihre Treue zum Lehrer, ihre Rangstreitigkeiten und ihre lebenslangen Bindungen. Er zeigt auf faszinierende Weise, wie Hand in Hand mit der neuen Lebensweise intellektuelle Veränderungen vor sich gingen, die bis heute fortwirken: Gelehrtes Wissen fächerte sich in unterschiedliche Disziplinen auf, es musste strengen Wahrheitsansprüchen genügen - und sollte auch noch nützlich sein. Am Ende dieser epochalen Wende europäischer Intellektualität steht die Geburt der Universität.
Als Peter Abaelard im 12. Jahrhundert den Vorrang der Vernunft in allen Fragen verkündete (und noch dazu ein Verhältnis mit seiner Schülerin Heloise begann), war das ein Skandal. Doch er war nicht der Einzige, der eigensinnig sein Wissen selbst erforschen und sein Leben dem neuen Projekt des «scholastischen» Wissens verschreiben wollte. Frank Rexroth erzählt, wie sich Schüler zu neuen Gruppen und Schulen zusammenfanden, beobachtet ihre Treue zum Lehrer, ihre Rangstreitigkeiten und ihre lebenslangen Bindungen. Er zeigt auf faszinierende Weise, wie Hand in Hand mit der neuen Lebensweise intellektuelle Veränderungen vor sich gingen, die bis heute fortwirken: Gelehrtes Wissen fächerte sich in unterschiedliche Disziplinen auf, es musste strengen Wahrheitsansprüchen genügen - und sollte auch noch nützlich sein. Am Ende dieser epochalen Wende europäischer Intellektualität steht die Geburt der Universität.

Von wegen dunkles Mittelalter: Frank Rexroth zeigt, wie bei den frühen Scholastikern die moderne Form von Wissenschaft auf die Bahn kam.
P. fällt ins Klo, P. fällt nicht ins Klo." Das hatte Aristoteles natürlich nicht selbst in seine Abhandlung über logische Aussagen hineingeschrieben. Auch der spätantike Römer Boethius, der die Schrift ins Lateinische übersetzt und kommentiert hatte, war es nicht. Nein, jenes Beispiel für die Symmetrie bejahender und verneinender Sätze, das sich in einer in München aufbewahrten Handschrift findet, muss irgendein mittelalterlicher Scherzkeks an den Rand gekritzelt haben, von wo es bei der nächsten Bearbeitung in den Text des Aristoteles-Kommentars geriet. Solche Kommentare waren bis ins zwölfte Jahrhundert hinein nicht Werke individueller Autoren, sondern hatten sich wie in Schichten über die Vorlagen aus der Antike oder der Kirchenväterzeit gelegt, kompiliert von Generationen von Magistern zum Gebrauch im Unterricht, in diesem Fall im Fach Dialektik.
Das Phänomen der exzessiven Glossierung überlieferter Texte ist für den Göttinger Historiker Frank Rexroth ein Symptom der Herausbildung dessen, was wir heute "Wissenschaft" nennen. Denn aus dem minutiösen Erklären noch jeder Kleinigkeit spreche offenbar "ein gefühltes Ungenügen vor allem an den boethianischen Kommentaren". Wissen beginnt hier mehr zu sein als etwas, das es sich anzueignen und weiterzugeben gilt. Vielmehr wird es "eigensinnig", wie Rexroth es in seinem Buch "Fröhliche Scholastik" ausdrückt. Das Wissen nimmt sich selbst in den Blick und damit auch seine Grenzen, was zu deren Ausweitung reizt, mithin zur Schaffung neuen Wissens über das Überlieferte hinaus. Der Wissensträger wird zum Wissenschaftler.
"Der Primärzweck einer so verstandenen Wissenschaft", schreibt Rexroth in seinem Buch über die frühe Scholastik, "ist es, wissenschaftliche Ergebnisse zu erbringen und nicht einen Beitrag zum Gemeinwohl, zur Vollbeschäftigung, zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit oder auch nur zur Rechtgläubigkeit der Menschen zu leisten." Und dieses Motiv bildete sich keineswegs erst in der Renaissance oder gar der Neuzeit heraus, sondern dort, wo Rexroth den Beginn der Scholastik verortet: im Mitteleuropa des elften und zwölften Jahrhunderts, mitten im vermeintlich dunklen Mittelalter.
Nun würde Rexroth eine Strohpuppe umrennen, käme es ihm nur darauf an, die intellektuelle Ehre der Scholastiker zu retten. Die hatten zwar von Martin Luther bis Jacob Burckhardt eine ausgesprochen schlechte Presse, und manche, insbesondere naturwissenschaftlich sozialisierte Zeitgenossen können sich noch heute nicht vorstellen, wie es zwischen Aristoteles und Descartes so etwas wie Wissenschaft überhaupt hatte geben können. Doch die Geschichtswissenschaft sieht das schon lange anders. "Die Scholastik ist nichts anderes gewesen als wissenschaftliches Denken", schrieb der protestantische Theologe und Kirchenhistoriker Adolf von Harnack 1897, im Todesjahr Burckhardts.
Woran Harnack und viele andere hier dachten, das war aber vor allem die sogenannte Hochscholastik, wie sie im dreizehnten Jahrhundert in Erscheinung trat, nach Herausbildung der ersten Universitäten und im Zuge der Wiederentdeckung der Hauptwerke des Aristoteles im lateinischen Westen durch Vermittlung islamischer und jüdischer Gelehrsamkeit. Doch die großen Namen dieser Epoche - Albertus Magnus, Bonaventura, selbst Thomas von Aquin - kommen bei Rexroth nur ganz am Rande vor, Wilhelm von Occam und Meister Eckhart nur in der einleitenden Übersicht über das Forschungsfeld und Johannes Duns Scotus sowie Roger Bacon überhaupt nicht.
Denn was Rexroth hier zeigen will, ist, dass die Wissen schaffende Wissenschaft sich bereits deutlich früher herausbildete, eine ganze Zeit vor der Gründung der ersten Universitäten und zunächst ohne die neuen geistigen Impulse von außen. Was sie etwa in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts hervorbrachte, das war kein institutioneller Wandel, wohl aber das Aufkommen einer neuen soziokulturellen Form der Gelehrsamkeit. Die war bis dahin in den Klöstern und Kathedralschulen gepflegt worden, daneben gab es umherziehende, "unternehmerisch tätige" Magister, die ihr Wissen gegen Bezahlung weitergaben. Denn Weitergabe war zunächst der alleinige Modus dieser Bildung, die vor allem Ausbildung war: Man erwarb sie zu einem Zweck, etwa zum Ausüben eines geistlichen Amtes. Gelernt wurde sie im antiken Kanon der "Sieben freien Künste", wobei die Fremdreferentialität des Wissens es mit sich brachte, dass man Rhetorik, Grammatik und Dialektik deutlich wichtiger nahm als Geometrie, Arithmetik, Astronomie oder Musik. Schließlich hatte ein Schüler in der Regel nur einen Lehrer, zu dem ein enges, oft lebenslanges Loyalitätsverhältnis bestand.
Doch in den Jahren um 1170 begann sich dieses soziokulturelle Gefüge des Lernens und damit auch des Wissens zu verändern. Die Zahl der "freien Schulen" wurde größer - zumindest mehren sich die Zeugnisse ihrer Kritiker, denen nicht zuletzt die dort immer größere Bedeutung der Dialektik aufstieß, also jener "freien Kunst", in der nicht zuletzt das verhandelt wurde, was wir heute Logik nennen. Zugleich begann sich das intime Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern zu lockern, studierte man nun doch durchaus nicht nur bei einem Meister. Damit war in den freien Schulen die Voraussetzung dafür gegeben, die Lehren der Magister nicht mehr länger als unanfechtbar zu nehmen.
Das Wissen wurde aufmüpfig: Die Frage nach dem Grund für die Geltung von Sätzen tauchte auf und nach den Bedingungen dafür, wann eine Aussage falsch ist. Der Fehler - bis dahin eine Art Erscheinungsform der Sünde und mithin eine moralische Kategorie - wurde säkularisiert und "Teil der Wissensordnung". Es konnte, es durfte, ja es musste diskutiert werden. Die methodische Disputation wurde die Form des Wettstreits der Scholasten, ein Nachdenken über Sprache manifestierte sich, und es ermöglichte "nicht nur Erkenntnisfortschritte, sondern auch eine Sensibilität für die Möglichkeit von Erkenntnisfortschritten".
Diese Herausbildung von Wissenschaftlichkeit ereignete sich natürlich nicht völlig aus sich allein heraus. Als historischen Hintergrund der Entwicklung macht Rexroth nicht zuletzt den Investiturstreit und die Kirchenreformen seit Papst Gregor VII. aus. Indem das Papsttum den weltlichen Fürsten die Oberhoheit über die Geistlichkeit entwand, kam es zu einer zunehmenden Hierarchisierung der Kirche und als Gegenbewegungen dazu zur Bildung von Eremitengemeinschaften, die in Waldeinsamkeiten urchristlichen Idealen nachstrebten.
Dieses soziale Phänomen überblendete sich nun mit dem der "freien Schulen", die sich die Gemeinschaft antiker Philosophen mit ihren Schülern zum Vorbild nahmen. Doch der Investiturstreit beförderte die Intellektualisierung auch direkt: Indem die Kirchenreformer und ihre Gegner sich auf die gleichen Schriftstellen beriefen, wurde vollends offenbar, dass viele Fragen nicht einfach durch Nachschlagen in der Bibel oder bei Augustinus zu klären sind.
Rexroths Kronzeuge für diese Prozesse ist Petrus Abaelardus (1079 bis 1142), dessen Wirken und Nachwirken zwei der zehn Kapitel des Buches gewidmet sind und der für fast alle Aspekte der neuen Wissenschaftlichkeit steht: Von der Emanzipation von den Kathedralschulen über die Dominanz der Dialektik bis zu den von Rexroth besonders unterstrichenen Spannungen mit der monastischen Welt. Abaelards Biographie, seine wohl einflussreichste Schrift "Sic et Non" ("Ja und Nein") und sein Konflikt mit dem Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux sind hier jeweils exemplarisch.
"Fröhlich" war diese Scholastik nicht aus Mangel an Ernst - von kleinen Derbheiten wie die des eingangs erwähnten Aristoteles-Bearbeiters vielleicht abgesehen. Eher im Gegenteil, war das Ganze eine konfliktreiche Absetzbewegung und auch darin einer Pubertät vergleichbar. Andererseits dürfte das neue, von keinen fremdreferentiellen Vorgaben eingeschränkte Schaffen theoretischen Wissens die frühen Scholastiker tatsächlich auch ergötzt haben, gibt es doch, wie jeder Wissenschaftler weiß, so etwas wie eine Freude am Argument, am Argumentieren und nicht zuletzt am Widerlegen anderer. Nicht zuletzt dies trug den frühen Scholastikern geradezu notwendig und wahrscheinlich nicht immer ganz zu Unrecht den Vorwurf der intellektuellen Arroganz ein - und in Abaelards Fall auch Ärger mit dem kirchlichen Lehramt.
Dieses aber mochte auf die neue Art, mit Wissen umzugehen und es zu mehren, bald selbst nicht mehr verzichten. Die Scholastik und ihre Methoden wurden gebraucht, und so standen die Zeichen auf Einhegung durch Institutionalisierung in den ersten Universitäten nach der Wende zum dreizehnten Jahrhundert, allen voran der von Paris.
Die "Universitas" begann als Zusammenschluss von Scholaren und Magistern nach dem Vorbild der Handwerksgilden, nachdem man aus der Waldeinsamkeit in die Städte zurückgekehrt war. Auch dies schildert Rexroth als einen eminent sozialen Prozess und weniger als einen, den die Inhalte des Wissens angestiftet hätten. "Man fühlte sich offenbar stärker, wenn man aus den vielen scholae die eine universitas machte."
Allerdings begegnete die zur Philosophie und reflektierenden Theologie mutierte Dialektik nun einem anderen Wissensfeld, das inzwischen ebenfalls ein Eigenleben entwickelt hatte: der Jurisprudenz. An die Zusammenführung beider in der Universität knüpfte sich jene bis heute nachwirkende Erwartung an die Wissenschaft, nicht nur Wahres zu produzieren, sondern auch Nützliches. Der selbstreferentiell forschende Eigensinn fand seine Grenzen, aber damit auch seinen dauerhaften Raum. Die Flegeljahre des Wissens jedoch waren vorbei.
All dies schildert Rexroth sehr klar und gewandt auf einem, gemessen an der Detailfülle seiner Darstellung, erfreulich knappen Raum. Und doch bleiben Fragen. So gibt er seinen Lesern kaum Hinweise zu wirtschaftlichen Aspekten, von denen schwer vorstellbar ist, dass sie nicht auch ursächlich in die untersuchten Prozesse hineinwirkten. Was, zum Beispiel, kostete der Unterricht bei einem freien Magister, und wer leistete sich das? Die andere Frage ist, ob das Mönchtum wirklich so pauschal in Opposition zum Wandel vom Wissen zur Wissenschaft gesehen werden kann, wie Rexroth es mitunter suggeriert. Vielleicht ist ihm zum Beispiel das Fragen des Benediktiners Anselm von Canterbury (1033 bis 1109) nach dem Zusammenspiel von Glauben und Wissen nicht "eigensinnig" genug. Doch als Urheber des "Proslogion"-Arguments, das später als sogenannter ontologischer Gottesbeweis Karriere machte, nahm auch Anselm das Wissen selbst in den Blick, schuf neues Wissen, ob man nun seine Gedankenführung für schlüssig hält oder nicht.
Rexroths zentraler Punkt und die eigentliche Leistung dieses Buchs bleibt davon freilich unberührt: Er kann seinen Lesern zeigen, wie das wissenschaftliche Denken im lateinischen Abendland vor den Universitäten aufkam und auch lange vor dem Humanismus und der folgenreichen Wiederentdeckung der Hauptwerke des Aristoteles. Tatsächlich hatte es zu all diesen Entwicklungen überhaupt nur kommen können, weil die Wissenschaft schon vorher da war.
ULF VON RAUCHHAUPT.
Frank Rexroth: "Fröhliche Scholastik". Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters. Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung / C. H. Beck Verlag, München 2018. 505 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Brillantes Buch."
Damals - Das historische Buch des Jahres 2019 - Platz 1 Kategorie Einzelstudie
"Lesenswertes Buch."
SWR2
"Ein überzeugendes Plädoyer für die Freiheit der Wissenschaften."
Neue Zürcher Zeitung, Susanne Reichlin
"Spannend und facettenreich erzählt."
Magdeburger News, Uta Luise Zimmermann-Krause
"Frank Rexroth beschreibt in seinem neuen Buch die Erfindung der europäischen Universität im Mittelalter. Es ergeben sich verblüffende Bezüge zu den heutigen Bologna-Hochschulen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Veronika Hock
Damals - Das historische Buch des Jahres 2019 - Platz 1 Kategorie Einzelstudie
"Lesenswertes Buch."
SWR2
"Ein überzeugendes Plädoyer für die Freiheit der Wissenschaften."
Neue Zürcher Zeitung, Susanne Reichlin
"Spannend und facettenreich erzählt."
Magdeburger News, Uta Luise Zimmermann-Krause
"Frank Rexroth beschreibt in seinem neuen Buch die Erfindung der europäischen Universität im Mittelalter. Es ergeben sich verblüffende Bezüge zu den heutigen Bologna-Hochschulen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Veronika Hock