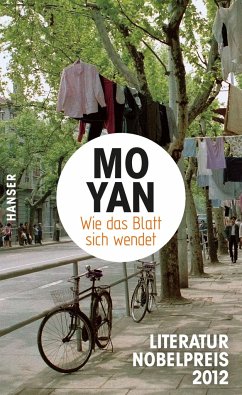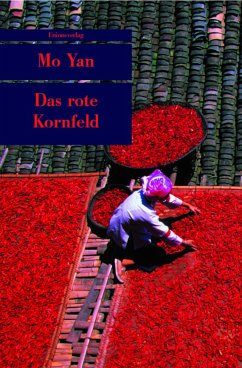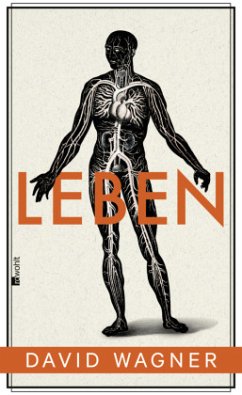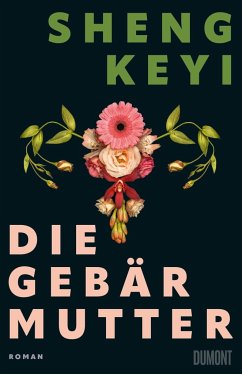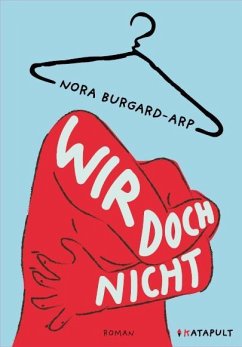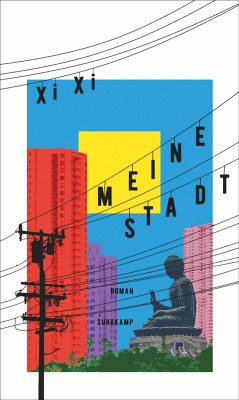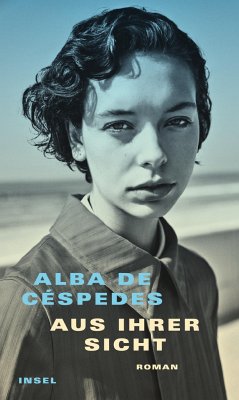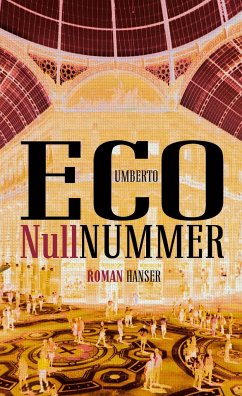Nicht lieferbar
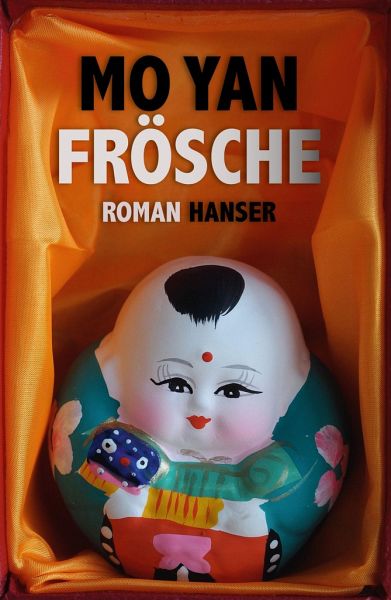
Frösche
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Dem chinesischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Mo Yan ist mit „Frösche“ eine kritische und vielschichtige Auseinandersetzung mit der kontrovers diskutierten Ein-Kind-Politik Chinas gelungen. Gerade westlichen Lesern bringt das Buch die jüngere chinesische Geschichte und die Gegenwart nahe und bewahrt sie so vor allzu einfachen Antworten zum Thema Geburtenkontrolle. In der Darstellung des Schicksals der ländlichen Bevölkerung zeigt sich Mo Yan als großer Erzähler, der mit genauem Blick für die Menschen und mit poetischer Raffinesse realistische mit magischen Momenten verbindet.
Frösche und die „weichen Hände“
Das Quaken der Frösche erinnert Gugu an das Weinen von Neugeborenen. Einst war der erste Schrei eines Kindes „die schönste und bewegendste Musik auf der ganzen Welt“ für sie. Doch in dem Froschgesang in ihren Albträumen hört sie nun Hass, „das Schreien von Wesen, die ihrer ganzen Würde beraubt wurden . . . Als wären es die Neugeborenen, an denen sie sich versündigt hatte, und deren Totengeister nun Anklage erheben würden.“
China in den 1950er-Jahren: In den Dörfern Nordost-Gaomis ist es Brauch, Kinder nach Körperteilen zu benennen; sie heißen Chen Nase, Wu Dickdarm oder Sun Schulter. So alt wie dieser Brauch sind die Geburtsmethoden auf dem Land. Gugu, Tochter eines Helden aus dem japanisch-chinesischen Krieg, hat früh eine moderne Ausbildung als Frauenärztin abgeschlossen und bringt als Hebamme bald tausende Säuglinge zur Welt. Dank ihres Wissens, ihres resoluten Wesens und ihrer „weichen Hände“ wird sie zu einer einflussreichen, von allen bewunderten Persönlichkeit: „Gugu wurde von den Dörflern – fast kann man sagen – in den Stand einer Göttin erhoben“, berichtet der Erzähler, ihr Neffe Wan Fuß. Unter dem Schriftstellernamen „Kaulquappe“ schildert er die Lebensgeschichte seiner Tante einem japanischen Schriftsteller in vier Briefpaketen – und in einem Theaterstück im letzten Kapitel des Romans.
Die Katastrophe der zweiten Geburt
Das Blatt wendet sich für Gugu und die Dörfler, als Mitte der 1960er-Jahre die Bevölkerung Chinas sprunghaft angestiegen ist. Gugu ist fortan nicht mehr nur Hebamme, sondern vor allem ausführendes Organ der Geburtenkontrolle und somit zuständig für Abtreibungen und Zwangssterilisierungen. Wie die Landbevölkerung, für die ein Sohn immer noch mehr als eine Tochter zählt, mit der Politik umzugehen und sie zu umgehen sucht, schildert Kaulquappe in eindrucksvollen, lebensnahen Szenen, die vom realistischen Erzählen in eine heiter-burleske Darstellung ins Ernste oder gar Brutale kippen. Die Zahl der Abtreibungen und damit einhergehenden Todesfälle steigt, Gugu wird von der Bevölkerung angefeindet. Bei unplanmäßig schwanger gewordenen Frauen geht die parteitreue Ärztin zunehmend brutal vor, „ihr ging kein überzähliges Kind durchs Netz! Sie kriegte sie alle zu fassen“. Zur persönlichen Katastrophe für den Erzähler kommt es, als dessen Frau Wang Renmei zum zweiten Mal schwanger wird. Mit einer Spezialeinheit, Megaphon und Kettenfahrzeug rückt Gugu an, droht Bäume und Häuser einzureißen, um Wang Renmei aus ihrem Versteck zu locken. Diese gibt schließlich mit den Worten nach: „Tante, ich bewundere Dich. Wärst Du ein Mann, würdest Du als ein Feldherr ganze Armeen befehligen.“ Bei der Abtreibung stirbt die hochschwangere Frau.
Mo Yan, sein Alter Ego und die Schuld des Schriftstellers
Mo Yan, Nobelpreisträger für Literatur, taucht in seinem Roman „Frösche“ tief in das Schicksal der ländlichen Bevölkerung und in die Geschichte Chinas der vergangenen 60 Jahre ein – von den Anfangsjahren der Volksrepublik über die Zeit der Kulturrevolution bis in die Gegenwart, in der reiche Parteikader mittels Leihmüttern die Politik zu umgehen suchen. Er zeigt die Zerrissenheit seiner Protagonisten, kontrastiert die staatlich propagierte Notwendigkeit der Geburtenkontrolle mit der Realität des ländlichen Chinas und stellt so die Ein-Kind-Politik zur Diskussion.
Der Erzähler Kaulquappe ist Mo Yans Alter Ego, dessen Tante Vorbild für die Figur der Gugu war. Für den Adressaten der Briefe stand der japanische Schriftsteller und Nobelpreisträger Kenzaburo Oe Pate, mit dem der Autor während der Entstehungszeit des Romans engen Kontakt hielt. Mo Yan fragt in „Frösche“ nach dem Verhalten des Einzelnen und reflektiert seine eigene, viel diskutierte Rolle als Schriftsteller. So schreibt er am Ende des Nachworts: „Wenn andere sich eines Verbrechens schuldig machen, bin ich mitschuldig.“
Das Quaken der Frösche erinnert Gugu an das Weinen von Neugeborenen. Einst war der erste Schrei eines Kindes „die schönste und bewegendste Musik auf der ganzen Welt“ für sie. Doch in dem Froschgesang in ihren Albträumen hört sie nun Hass, „das Schreien von Wesen, die ihrer ganzen Würde beraubt wurden . . . Als wären es die Neugeborenen, an denen sie sich versündigt hatte, und deren Totengeister nun Anklage erheben würden.“
China in den 1950er-Jahren: In den Dörfern Nordost-Gaomis ist es Brauch, Kinder nach Körperteilen zu benennen; sie heißen Chen Nase, Wu Dickdarm oder Sun Schulter. So alt wie dieser Brauch sind die Geburtsmethoden auf dem Land. Gugu, Tochter eines Helden aus dem japanisch-chinesischen Krieg, hat früh eine moderne Ausbildung als Frauenärztin abgeschlossen und bringt als Hebamme bald tausende Säuglinge zur Welt. Dank ihres Wissens, ihres resoluten Wesens und ihrer „weichen Hände“ wird sie zu einer einflussreichen, von allen bewunderten Persönlichkeit: „Gugu wurde von den Dörflern – fast kann man sagen – in den Stand einer Göttin erhoben“, berichtet der Erzähler, ihr Neffe Wan Fuß. Unter dem Schriftstellernamen „Kaulquappe“ schildert er die Lebensgeschichte seiner Tante einem japanischen Schriftsteller in vier Briefpaketen – und in einem Theaterstück im letzten Kapitel des Romans.
Die Katastrophe der zweiten Geburt
Das Blatt wendet sich für Gugu und die Dörfler, als Mitte der 1960er-Jahre die Bevölkerung Chinas sprunghaft angestiegen ist. Gugu ist fortan nicht mehr nur Hebamme, sondern vor allem ausführendes Organ der Geburtenkontrolle und somit zuständig für Abtreibungen und Zwangssterilisierungen. Wie die Landbevölkerung, für die ein Sohn immer noch mehr als eine Tochter zählt, mit der Politik umzugehen und sie zu umgehen sucht, schildert Kaulquappe in eindrucksvollen, lebensnahen Szenen, die vom realistischen Erzählen in eine heiter-burleske Darstellung ins Ernste oder gar Brutale kippen. Die Zahl der Abtreibungen und damit einhergehenden Todesfälle steigt, Gugu wird von der Bevölkerung angefeindet. Bei unplanmäßig schwanger gewordenen Frauen geht die parteitreue Ärztin zunehmend brutal vor, „ihr ging kein überzähliges Kind durchs Netz! Sie kriegte sie alle zu fassen“. Zur persönlichen Katastrophe für den Erzähler kommt es, als dessen Frau Wang Renmei zum zweiten Mal schwanger wird. Mit einer Spezialeinheit, Megaphon und Kettenfahrzeug rückt Gugu an, droht Bäume und Häuser einzureißen, um Wang Renmei aus ihrem Versteck zu locken. Diese gibt schließlich mit den Worten nach: „Tante, ich bewundere Dich. Wärst Du ein Mann, würdest Du als ein Feldherr ganze Armeen befehligen.“ Bei der Abtreibung stirbt die hochschwangere Frau.
Mo Yan, sein Alter Ego und die Schuld des Schriftstellers
Mo Yan, Nobelpreisträger für Literatur, taucht in seinem Roman „Frösche“ tief in das Schicksal der ländlichen Bevölkerung und in die Geschichte Chinas der vergangenen 60 Jahre ein – von den Anfangsjahren der Volksrepublik über die Zeit der Kulturrevolution bis in die Gegenwart, in der reiche Parteikader mittels Leihmüttern die Politik zu umgehen suchen. Er zeigt die Zerrissenheit seiner Protagonisten, kontrastiert die staatlich propagierte Notwendigkeit der Geburtenkontrolle mit der Realität des ländlichen Chinas und stellt so die Ein-Kind-Politik zur Diskussion.
Der Erzähler Kaulquappe ist Mo Yans Alter Ego, dessen Tante Vorbild für die Figur der Gugu war. Für den Adressaten der Briefe stand der japanische Schriftsteller und Nobelpreisträger Kenzaburo Oe Pate, mit dem der Autor während der Entstehungszeit des Romans engen Kontakt hielt. Mo Yan fragt in „Frösche“ nach dem Verhalten des Einzelnen und reflektiert seine eigene, viel diskutierte Rolle als Schriftsteller. So schreibt er am Ende des Nachworts: „Wenn andere sich eines Verbrechens schuldig machen, bin ich mitschuldig.“