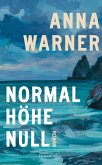»Ich glaube an den Verstand, den freien Willen und die Kraft der Gedanken. Ich glaube an Biochemie, Serotoninmangel und erhöhte Entzündungswerte. Ich glaube an Alkohol und Penetration, an die Sehnsucht nach Selbstaufgabe und die Würde des Scheiterns. Ich glaube an die Wirksamkeit von Psychopharmaka - und sogar daran, ein schönes Leben zu haben.«
Das Leben ist gut - solange wir es nicht daran messen, wie wir es uns vorgestellt haben. Isabelle Lehn schreibt über eine Frau namens Isabelle Lehn. Poetisch, selbstironisch und umwerfend offen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Das Leben ist gut - solange wir es nicht daran messen, wie wir es uns vorgestellt haben. Isabelle Lehn schreibt über eine Frau namens Isabelle Lehn. Poetisch, selbstironisch und umwerfend offen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
[...] eine erstaunliche Direktheit, Frechheit, Unverschämtheit im Wortsinne - also ohne Scham von sich selber zu erzählen [...] Hubert Winkels Deutschlandfunk 20190610

Bin das denn ich? Isabelle Lehns Roman "Frühlingserwachen" changiert zwischen Autobiographie und Fiktion
Als Francis Bacon sagte, dass es die "Aufgabe des Künstlers" sei, "das Geheimnis zu vergrößern", hatte er mehr im Sinn als die Brisanz einer Handlung oder die Drastik eines Motivs. Auch das Geheimnis der Literatur steckt nicht in ihrem Inhalt, ein Plot formt noch längst keine Geschichte. Wie ist es etwa mit Romanen, deren Handlung Züge einer Selbstinquisition trägt? Isabelle Lehns zweites Buch, "Frühlingserwachen", ist ein solcher Fall. Es ist die Ausräumung aller Geheimnisse, die Lüftung auch der staubigsten Ecken einer menschlichen Existenz.
Die Erzählerin dieses Romans in Jahreszeitenabfolge trägt den gleichen Namen wie die Autorin. Isabelle ist siebenunddreißig Jahre alt, geschieden und neu liiert mit dem Jazzmusiker Vadim. Als bisher nicht erfolgreiche, wenngleich scheinbar kurz vor dem Durchbruch stehende Schriftstellerin verkehrt sie gern und häufig in Bars mit sprechenden Namen wie dem "Besser Leben". Es herrscht hier ein unentscheidbares Nebeneinander von Autobiographie und Fiktion. Die neue Ich-Literatur, wie sie Maxim Biller einst nannte, reklamiert alle Freiheit der Fiktion für sich, beansprucht aber zugleich Unmittelbarkeit und Authentizität. Vielleicht hat es der Fall Benjamin Stuckrad-Barre am populärsten vorgemacht: Die Entblößung und Analyse des eigenen Selbst mündet nicht selten in einer Überbietungslogik des Ekels. Wie abgründig kann ein Ich sein?
Entlang dreier Grundthematiken sinniert und lamentiert Isabelle über ihr Leben: Depression, Reproduktion, Schriftstellerei. Notizen wie "meine Medikamente absetzen", "mich einer Hormonkur unterziehen", "auf Verlagssuche gehen" werden zum Auftrag, den die Erzählerin an sich selbst richtet, mit Augenzwinkern Richtung Popliteratur notiert in einer Liste. Dass diese Liste eingeleitet wird mit "Dinge, auf die ich im Frühjahr lieber verzichten will" heißt, dass auch Isabelle weiß, dass ihre diesjährige Neuerfindung eine gebrauchte aus dem letzten Jahr, eine bereits durchgespielte ist. Wie auch die Verzweiflung angesichts der ausbleibenden Schwangerschaft sich anfühlt wie ein Zitat. Das hatten wir schon einmal, vielleicht im letzten Frühjahr.
Dabei ist der Kinderwunsch janusköpfig. Isabelle hat ihn nicht direkt, ihr Gefühl ist, so wie meist in diesem Roman, vermittelt über Umstehende, über Gefühlsspender. Die Tante möchte es, die Eltern Vadims auch, und Isabelle fragt nicht ganz ohne Pose: "Wann ist man zu alt, um sich zu jung für ein Kind zu fühlen?" Dennoch wird der ausbleibende Nachwuchs zum Inbegriff der Möglichkeit, eine andere zu werden. Eine andere, die endlich authentisch ist, eine andere ohne diffizile Körperlichkeit. "Und immer ist da dieses Verlangen, aller Welt zu erklären, dass ich eigentlich eine andere bin. Dass hier eine Verwechslung vorliegt: Ich mag hier stehen. Aber das bin doch nicht ich!"
Die Banalität der Depression ist das vertraute Knistern der Aluminiumfolie bei der täglichen Tablettenentnahme sowie die verstärkte analytisch-skeptische Selbstschau, als Isabelle sich dazu entscheidet, das Medikament abzusetzen. Die ebenso schlafwandlerische Routine der Beobachtung der eigenen Existenz bekommt der Leser in sprachlicher Hinsicht vermittels eines ausgiebigen Gebrauchs der Präsensformen von Verben einfachster Ordnung in den Kopf gehämmert: Stets passiert das Nichts in diesem Moment, jetzt "sagt der Therapeut", "denkt der Therapeut", "gehe ich zum Arzt", "prüft der Arzt meine Behaarung". Es ist eine der größeren Stärken dieses Textes, den Ereignissen ihre Ereignishaftigkeit zu nehmen, indem ein großer Schleier postpubertärer Langeweile über sie gelegt wird. Alles wiederholt sich, keine Singularität in der Welt, selbst der Tag, an dem sich alljährlich die depressive Verstimmung zur Depression ausweitet, ist "ein berechenbares Datum ohne Symbolik, an dem der Durchschnittsirre kapituliert".
Und die Schriftstellerei? Ganz gemäß der Logik der Geschichte, die den autobiographischen Pakt mit dem Leser aufbricht, so oft es geht, plagt sich Isabelle mit dem Schreiben eines Buchs. Eines über ihr "Innerstes, das sich schreibend nach außen stülpt, bevor es in die Kloschüssel fällt". Natürlich ist es das Buch, das wir in Händen halten. Als die Literaturagentin den lang erwarteten Verlag auftut, stellt sich die Freude wieder nur bei den anderen ein. Lehn spürt stattdessen den Druck, der von der hereinbrechenden Normalität, von der Stabilisierung einer Existenz ausgeht.
Das alles ist eine Zumutung für den Leser, der auf Isabelles Hoffnungen einsteigt und sich eine Verbesserung der Situation verspricht, der darauf wartet, dass eines der Geschehnisse in diesem Roman eine unerwartete Wendung, eine Schmälerung von Isabelles gewichtigem Weltenleid herbeiführt. "Ruhe, Stille, Gleichgültigkeit" herrschen im Schutzraum ihrer Depression, dessen Verlassen niemals Ziel der Erzählerin war, auch wenn sie dies sich selbst und somit dem Leser beständig versichert. Die perfide Logik des Textes mag der Logik einer Depression nicht unähnlich sein. Die tägliche Geschichte, die man sich erzählt, ist eine selbstbetrügerische, eine von der Normalität der anderen und der tiefen Zerstörtheit der eigenen Existenz.
Wer es schafft, bis zum Ende des Romans mit all seiner neurotisch übersteigerten Selbstbezüglichkeit und dem fortwährenden Berauschtsein an der eigenen Abgeklärtheit durchzuhalten, spürt die Veränderung an sich. Unter der Hand gerät Isabelles Lamento, die quälerische Selbstschau einer sehr klugen Frau, zum Splitter einer Ästhetik der Emotionslosigkeit. Wer am Anfang mithoffte, hat die Hoffnung am Ende verloren, auch wenn dann wieder Frühling wird. Statt der Vertiefung des Geheimnisses findet man in diesem Buch die Entfaltung des Profanen, den Ennui eines ganz normalen weiblichen Lebens, das nicht gelingen will.
MIRYAM SCHELLBACH
Isabelle Lehn: "Frühlingserwachen". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2019. 256 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main