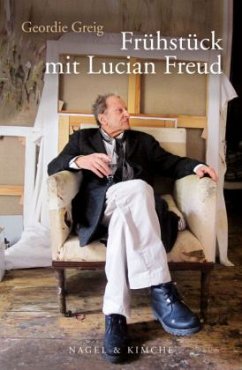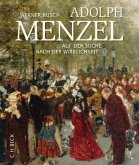Um das Leben des Malers Lucian Freud ranken sich viele Gerüchte - nicht zuletzt, weil er Privates rigoros vor der Öffentlichkeit abschirmte. Geordie Greig gehörte zu Freuds engsten Vertrauten, mit ihm teilte er Geschichten aus seinem Leben, das voller Arbeitswut, grausamer Rücksichtslosigkeit und einer fatalen Hang zum Glücksspiel war. Greig enthüllt in seiner Biographie eine faszinierende Persönlichkeit, für die jeder aus der High Society liebend gern Modell sitzen wollte, obwohl es monatelange Tortur bedeutete. Illustriert mit vielen unbekannten Fotos und Bildern, ist diese Biographie eines der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts zugleich ein lebendiges Stück Kunstgeschichte.

Es geht nicht um Kunst, hier geht es um Klatsch: Der englische Journalist Geordie Greig gehörte zum inneren Zirkel um den Maler Lucian Freud. Daraus schlägt er jetzt Kapital. Als Biograph taugt er nicht.
Bei Lucian Freud musste alles nach seinem Kopf gehen. Der Mann, den Geordie Greig als den größten realistischen, figürlichen Maler des zwanzigsten Jahrhunderts verehrt, war ein Kontrollfreak. Wehe dem, der sich seinen Wünschen widersetzte! Von den vielen Frauen, die seinem dämonischen Charme erlagen und ihm mindestens vierzehn Kinder gebaren - die Gerüchteküche spricht mitunter von bis zu vierzig -, verlangte Freud unbedingte Hingabe.
Er drückte sich seinerseits jedoch vor jeder Form von Bindung, damit seiner Malerei nichts im Wege stehe. 1954 schrieb er in einer künstlerischen Stellungnahme: "Ein Maler muss sich alles, was er sieht, vorstellen als etwas, was ausschließlich für seinen Gebrauch und sein Vergnügen da ist." Sich über Konventionen, Verpflichtungen und bürgerliche Moral hinwegsetzend, lebte Freud nach der Devise, dass die Kunst den Egoismus rechtfertige, zu dem er sich denn auch freimütig bekannte.
In seiner Mischung aus widerspenstigem Eigensinn und triebhafter Schaffenslust war er zu keinerlei Kompromiss gewillt. Er versuchte, die parallel verlaufenden Fäden seines Lebens auseinanderzuhalten, und legte den Menschen in seinem engsten Umfeld ein mafiaähnliches Schweigegelübde auf. Wer diese Omertà brach, wurde aus dem Zauberkreis verbannt. An seiner Türklingel stand kein Name. Einige seiner guten Bekannten wussten nicht einmal, wo er wohnte, und er verzichtete lieber auf sein Wahlrecht, als den Behörden seine Adresse preiszugeben für den Eintrag im Wählerverzeichnis. Nur die wenigsten besaßen seine Telefonnummer. Es gab sogar ein Jahr, in dem Freud die Telefonnummer viermal wechselte, um sich lästige Anrufe vom Leib zu halten.
Das Bedürfnis, die eigene Privatsphäre zu schützen, ging so weit, wie er dem Verfasser von "Frühstück mit Lucian Freud" verriet, dass, wenn ihn ein Taxifahrer vor einem Kino abgesetzt hatte, der nächste Impuls war, gleich in einem anderen Taxi zu einem anderen Kino zu fahren, "nur damit niemand wusste, wo ich bin".
Sein Großvater Sigmund Freud hätte seinen Spaß gehabt mit dieser nahezu paranoiden Geheimniskrämerei, vom Mutterkomplex und anderen Marotten nicht zu reden. Sein erstes Wort sei "allein" gewesen, behauptete Lucian Freud in einer postum gesendeten BBC-Dokumentation. Dabei lebte er nicht so abgeschieden, wie die von ihm gelenkten Mythenmacher glauben machen wollten. Er war ein geselliger Einzelgänger, der sich gern in feinen Restaurants blicken ließ, wo er die Gesellschaft mit Basiliskenblick musterte. Es gefiel ihm, eine Aura der Unnahbarkeit zu schaffen, welche die Neugier bloß anfachte.
Interviewanfragen wurden in der Regel abgelehnt, oft mit schroffen Briefen; ein nicht autorisierter Biograph gab seine Forschungen nach einer anonymen Einschüchterungskampagne auf und erklärte, nach dieser Erfahrung würden ihn keine zehn Pferde mehr dazu bringen, über eine lebende Figur zu schreiben; und der Kunstkritiker William Feavor, den Freud zunächst ermutigt hatte, an einer Biographie zu arbeiten, musste das Projekt auf Eis legen, weil der Künstler fürchtete, dass zu viele Intimitäten an die Öffentlichkeit gelangen würden.
Bei alledem drängt sich die Frage auf, weshalb Lucian Freud gerade bei Geordie Greig eine Ausnahme machte, zumal es diesem in "Frühstück mit Lucian Freud" vorrangig um das Privatleben geht. Der Journalist war ein siebzehnjähriger Abiturient in Eton, als er 1978 bei einem Klassenausflug zum ersten Mal ein Bild von Lucian Freud sah. Greig fand ihn "genauso faszinierend wie die Sex Pistols oder The Clash" und versuchte den Künstler für ein Interview in der Schülerzeitung zu gewinnen. Es war die erst von zahlreichen Anfragen im Laufe von fast fünfundzwanzig Jahren, in denen Greig seine Ausbildung abschloss und im Journalismus Karriere machte.
Seine Briefe blieben allesamt unbeantwortet bis auf einen, in dem Freud schrieb, ihm werde schlecht bei der Vorstellung, von Greig interviewt zu werden. Jedoch zahlte sich die Beharrlichkeit des Journalisten schließlich aus. Im Jahr 2002 gewährte ihm der achtzig Jahre alte Freud einen Frühstückstermin - um 6.45 Uhr in seinem Atelier.
Greig, damals noch Chefredakteur der Hochglanzzeitschrift "Tatler", gehörte nun zu den Auserwählten, die der Künstler regelmäßig zum Frühstück empfing bei "Clarke's", einem sympathischen Londoner Restaurant, das Freud von seinem als "eine Kreuzung aus Tischlerei und aristokratischem Salon" beschriebenen Haus in nur wenigen Schritten erreichen konnte. Morgens, bevor die anderen schicken Gäste, die dort verkehrten - der inzwischen zum Chefredakteur der "Mail on Sunday" avancierte Greig rasselt in bewährter Boulevardzeitungstradition von Maggie Smith bis Prinz William und Kate eine Reihe von Namen herunter -, Zulass fanden, nutzte Freud das Lokal als seinen Privatsalon.
Durch seinen Tod im Juli 2011 fühlten sich viele aus seinem Zirkel offenbar von ihrem Schweigegebot befreit. Freunde, Geliebte und Kinder öffneten Greig ihr Herz, zumal sie wussten, dass der Künstler eine segnende Hand auf ihn gelegt hatte. Ihre Informationen werden mit den Aussagen verschmolzen, die der Autor in seinen Begegnungen mit Freud gesammelt hat. Es zeugt von seiner magischen Anziehungskraft, dass die meisten, die er in seinen Bann zog, trotz der Kränkungen und Brüskierungen zu ihm halten.
Eine Nonne, die einen Stall führte, wo Freud zu reiten pflegte, bescheinigte ihm schamanische Kräfte im Umgang mit Pferden. Er selbst sei "geradezu animalisch" gewesen in seinem Instinkttrieb, erzählt der Buchmacher, bei dem der stets den Nervenkitzel suchende Freud Millionen von Pfund verwettete: "Er ging nach seinem Bauchgefühl, nahm sich, was er haben wollte. Das war seine Stärke. Man konnte das auch an seinem alltäglichen Verhalten sehen. Er aß mit den Fingern, riss das Geflügel auf seinem Teller in Stücke." Der Kunstkritiker John Richardson meinte, Freud habe eine Art psychische Macht über Tiere besessen.
Bei den Menschen, die er ebenfalls als Tiere sah, scheint es nicht anders gewesen zu sein. In seinen Bildern liegen die Aktmodelle da wie Opferfleisch. Sie liefern sich seinem sezierenden Blick aus, als seien sie einen seltsamen sadomasochistischen Pakt eingegangen. Eine seiner Geliebten berichtet, sie habe sich wie auf Entzug gefühlt, als die Beziehung zerbrach.
Bei aller Verehrung, die Greig seinem Sujet entgegenbringt, und bei aller Faszination der Figur steigt ein abstoßender Geruch aus diesem eilig geschriebenen, boulevardesken Buch. Man erfährt zu wenig über die Kunst und zu viel Klatsch, so dass man jenen antibiographischen Künstlern recht geben will, die wie der Dichter W.B. Yeats dafür plädieren, dass das Werk getrennt werde von dem "Bündel aus Zufall und Inkohärenz, das sich zum Frühstück hinsetzt".
Der zwischen Adel und Unterwelt lebende Freud schlägt einem Kellner, der ihn vergrätzt, die Faust ins Gesicht, er prügelt sich im Supermarkt, tritt dem Kunsthändler Jay Jopling ans Schienbein, hetzt Feinden seine Ganovenfreunde auf den Hals, rächt sich an einer Freundin, indem er sie beim Verrichten ihrer Notdurft darstellt, verstößt eine Tochter, als sie ihm mitteilt, dass ihr Kind nicht Modell sitzen werde, und behauptet, dass Frauen sich erst dann richtig hingäben, wenn sie zu Analsex bereit seien. Freud sei "dunkel und heruntergekommen", klagt der Schriftsteller Laurie Lee, dem Freud eine Freundin ausspannte. Die Tochter einer Aristokratin, mit der Freud lange liiert war, nennt ihn "bösartig und bezaubernd".
Die meisten Künstler würden sich gegen eine derart plastische Darstellung der Abgründe in ihrem Leben wehren. Freud scheint es im Angesicht des Todes so gewollt zu haben. Es gefällt ihm, dass er als verschlagen und ungreifbar beschrieben wird. Und er fühlt sich geschmeichelt, als man ihm einen Tagebucheintrag von Laurie Lee zeigt, in dem er als unangenehmer Irrer bezeichnet wird, der bei der gemeinsamen Freundin eine Sehnsucht nach Verdorbenheit anspreche. Laut Lees Biographin wollte Freud "als unmoralischer junger Mann und wahrer Bohemien gesehen werden", berichtet Greig, der sich offenen Auges instrumentalisieren lässt.
Die auf Hochglanzpapier produzierte englische Ausgabe ist weitaus schöner als die deutsche, der außerdem das Inhaltsverzeichnis abhandengekommen ist. Dem mit den Feinheiten der britischen Gesellschaft weniger vertrauten Leser wäre mit gelegentlichen Anmerkungen gedient gewesen. Von dem Rohstoff, den "Frühstück mit Lucian Freud" liefert, wird die Fachliteratur zehren. Für eine differenziertere Darstellung von Leben und Kunst wird man allerdings auf William Feavors für 2015 angekündigte Biographie warten müssen.
GINA THOMAS
Geordie Greig: "Frühstück mit Lucian Freud". Aus dem Englischen von Matthias Fienbork. Nagel & Kimche Verlag, Zürich 2014. 272 S., Abb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Lucian Freud hat es genossen, für unmoralisch, dunkel und animalisch gehalten zu werden, weiß Gina Thomas, und nach Lektüre dieses Buchs kann sie seinem Autor nur attestieren, dem Maler ausgesprochen dienlich gewesen zu sein. Trotzdem kann sie nicht verstehen, warum der Maler, der zeit seines Lebens ein solches Aufhebens um seine Privatsphäre gemacht hat, der sich nicht einmal in Wählerverzeichnis eintragen ließ und seinen Vertrauten ein absolutes Schweigegelübde abverlangte, sich ausgerechnet diesem Journalisten anvertrauten. Geordie Greig war Chefredakteuer des "Tatlers" und dann der "Mail on Sunday" und er tischt in seinem Buch alles auf, was er an Klatsch und Tratsch über den Maler hat zusammentragen können, über seine mindestens vierzehn Kinder, seine magische Macht über Tiere, seine verwetteten Millionen. Auch wenn Freud immer "zwischen Adel und Unterwelt" gelebt habe, ist das der Rezensentin nicht genug.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH