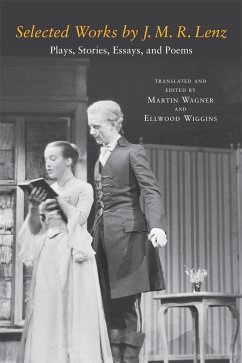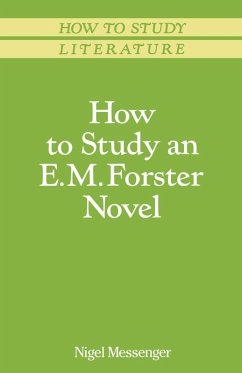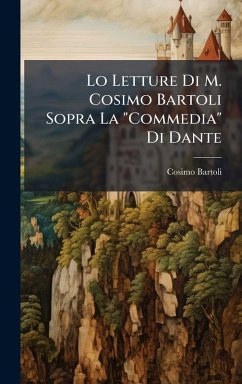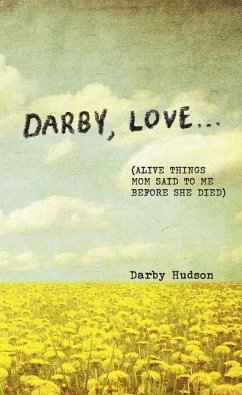Fümms bö wö tää zää Uu, m. Audio-CD
Stimmen und Klänge der Lautpoesie. Ausgezeichnet mit dem Deutsche Hörbuchpreis 2003 für Beste Inovation und von der Darmstädter Jury als Buch des Monats Juni 2003 ausgezeichnet. 60 Min.
Herausgegeben von Scholz, Christian; Engeler, Urs
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
48,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Fümms bö wö tää zää Uu, m. Audio-CD
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.