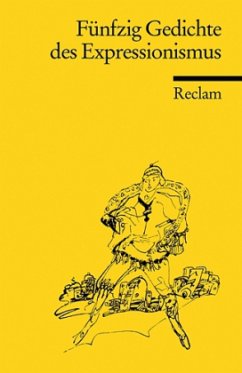Ernst Stadlers Aufruf "Mensch, werde wesentlich" mag als Leitspruch über dem gesamten Expressionismus stehen. Gleichwohl zeigt die Lyrik der Zeit eine Vielzahl von Themen und Tönen: Von der Zerstörung des Wilhelminisch-Untertänigen bis zu Visionen von Apokalypse und Paradies. Von der Entdeckung der sozialen Wirklichkeit bis zum Aufgehen des Menschen in der Natur. Von der bitteren Klarheit des Zynismus bis zum O-Mensch-Pathos.

"Weltende" - Ein Gedicht von Jakob van Hoddis · Von Lorenz Jäger
Man kennt die Vorahnungen der jungen Dichter um 1910, ihre Gedichte, die den Krieg voraussahen, und man weiß, wie bald sie verschwanden: Georg Heym ertrank beim Schlittschuhlaufen, Alfred Lichtenstein fiel im Spätsommer 1914, Jakob van Hoddis versank im Stumpfsinn. Neben Georg Heyms Gedicht "Der Krieg" hat sich kein anderes so behaupten können wie die acht Zeilen von "Weltende", das Gedicht des dreiundzwanzigjährigen van Hoddis, das seine Zeit so prägnant erfasste, dass es sofort Schule machte, bewundert, nachgeahmt und zum Epochenwerk erklärt wurde. 1911 erschien es in der Zeitschrift "Der Demokrat": "Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, / In allen Lüften hallt es wie Geschrei. / Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei / Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut. // Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen / An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. / Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. / Die Eisenbahnen fallen von den Brücken." Zwei Jahre später wurde es in Franz Pfempferts "Aktion" nachgedruckt, bis heute hat es immer wieder seine Leser gefunden.
Man kann positivistisch zunächst nach den Quellen des Gedichts fragen. Regina Nörtemann, die Herausgeberin der Kritischen Ausgabe, hat sie in Katastrophenmeldungen gefunden, die im "Berliner Tageblatt" vom Dezember 1909 im Laufe weniger Tage aufeinander folgten: in dem "Orkanartigen Sturm", der aus Berlin gemeldet wird, in der "Sturmflut auf dem Wattenmeer" und in dem "Eisenbahnabsturz in der Vereinigten Staaten".
Man könnte auch nach den historischen Gründen dieses Sturms fragen, den die expressionistische Generation entdeckte. Und man kann sich ans Nächstliegende halten: Der Hut ist weg, das Dach bleibt schadhaft. Was da bei van Hoddis von oben kommt, ist niemals ganz geheuer. Es können ungeahnte Wunder sein: "In Indien - sagt man - weint der Mond Kristalle", heißt es in einem anderen Gedicht. Oben liegt die unbestimmte Drohung - "Im Himmel liegen Schwerter wo verborgen" - ebenso wie der böse Witz - "Ein Teufelslachen bleckt am blauen Himmel" - und schließlich die banale Blödelei: "Der Mond ist meine Tante / Er schmoddert durch die Nacht." Kometen und zerrissene Dachfahnen, die in den Gedichten wiederkehren, ergänzen das Bild der intellektuellen Spannung, die sich über den Köpfen zusammenbraut.
Aber wer unter der geistigen Avantgarde sprach damals nicht vom Untergang? "Du, Du, Welt-Ende" ist das erste Kapitel von Erich Gutkinds Traktat "Siderische Geburt" überschrieben, erschienen 1910. Man liest dort einen expressionistischen Hymnus auf das "Unerhört Neue", das bevorsteht: "Uns kann kein Weltbild mehr genügen, sondern einzig das Weltende, und das Ende kann uns nicht mehr schrecken." Prophezeit wird das Ende einer erschöpften Kultur. Gutkind fand in Kandinsky und anderen heroischen Künstlern der Moderne ein begeistertes, wenn auch kleines Publikum. Joachim Storck hat zurecht darauf hingewiesen, dass van Hoddis dieses Pathos nur aufnimmt, um es sogleich zu banalisieren. Dass die meisten Menschen einen Schnupfen haben, dass die Dachdecker "entzwei gehen" wie Spielzeug - das sind Aussagen, die wie ein verhöhnendes Nachäffen der kulturpessimistischen Philosophen anmuten. Banalisierung war die Strategie, mit der sich van Hoddis vom Betrieb der Bildung ebenso absetzte wie vom Betrieb der Kritik.
1887 wurde Hans Davidsohn, der seinen Namen später anagrammatisch verwandelte, in Berlin geboren. Seine ersten Gedichte schrieb er als Knabe unter dem Pseudonym Juan Centella - "Der Funke" - und gab damit einen Hinweis auf das jähe Aufleuchten, dem keine Dauer beschieden war. Was er anstrebte, war ein dichterisch großes Bild der städtischen Laster, der Metropolen-Nächte. Er identifizierte sich mit den Parias. Apologien des nackten, schamlosen Genusses schrieb er: über das Leben in Kneipen, Kinos und in Varietes, rauchend, trinkend, "geil und gähnend". Schon ein Jugendgedicht feiert den Himmel der Muslime im Sinne einer Gegenmoral: "Herrlich sind des Sel'gen Freuden / Herrlich schwelgt er im Genuß." Eine Bildungsreise wird ihm zur Apotheose der Faulenzerei: "So waren wir auch in Italien Gäste, / Und haben dort so manchen Tag verschlafen. / Wir tranken Wein in Kinematographen, / Und krochen durch die Gärten und Paläste." Und wo es um die letzten Dinge ging, blieb nur die Frage: "Ob es im Himmel wohl Sekt gibt?"
Immerhin tat sich am Himmel so viel und so Beunruhigendes, dass an Schutzmaßnahmen gedacht werden musste. Der Dichter durchlief eine katholische Phase, angeregt von Emmy Ball-Hennings, die viele Konversionen der Avantgarde auf dem Gewissen hatte. Und weil das Oben fraglich blieb, waren Fragen der Kopfbedeckung für van Hoddis zeitlebens aktuell. In einem der ersten Gedichte des fünfzehnjährigen Knaben erhält ein Sultan einen riesigen Rubin, der feindlich-blutrot strahlt. Der Herrscher zerschlägt den Edelstein - und aus den Scherben fertigt der Hofjuwelier eine Krone, "die er dem Sultan beut". In dem Gedicht "Hamlet" liest man: "Wir tragen dies wie einen Herrscherstab / Und einen Helm der blendet und versteint", und ein anderes Mal: "Ich weiss, dass Rächer harren / Geschlossenen Helmes." Aber als Kronen, Helme und Hüte dann wirklich fielen, war van Hoddis als Dichter verstummt.
1915 kommt er in Privatpflege; später, als er wegen Ausbrüchen von Jähzorn und allgemeiner Verwahrlosung für die Familie des Gastwirts Dieterle unzumutbar wird, in eine Göppinger Anstalt. Seine Mutter emigriert nach Palästina. Am 30. April 1942 wird Jakob van Hoddis deportiert und kurz darauf in einem Lager im Osten ermordet. 1927 hält eine Tübinger Krankenakte die letzten Gesten fest, die wir von van Hoddis kennen. Der irre Bürger hatte sich mit dem Hut versöhnt, indem er die Banalität zum äußersten trieb: "Zeigte eine große Ehrerbietung vor Hunden", heißt es da. "Grüßt alle Hunde und auch andere Tiere durch Hutabnehmen."
"Gedichte des Expressionismus". Herausgegeben von Dietrich Bode. Reclam Verlag, Stuttgart 1998. 206 S., br., 10,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main