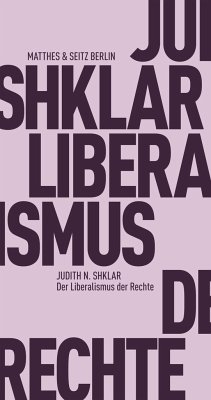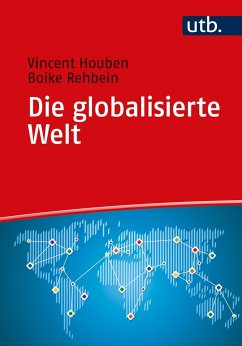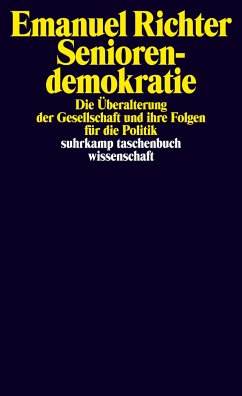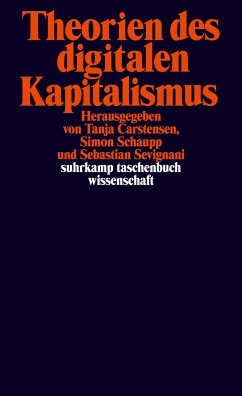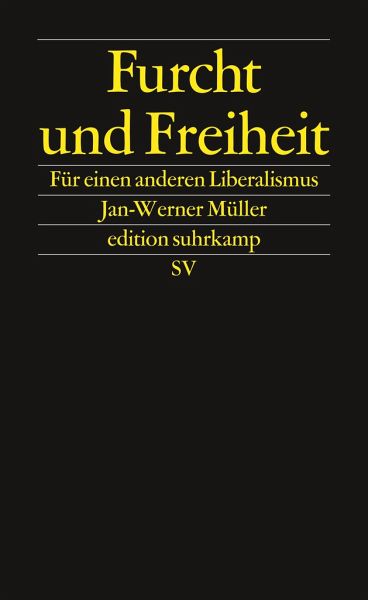
Furcht und Freiheit
Für einen anderen Liberalismus

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Liberalismus ist in Verruf geraten. Oft wird er nur noch als Elitenattitüde wahrgenommen, als exklusive Kultur urbaner Globalisierungsgewinner. Wie konnte es so weit kommen? War der Liberalismus schon immer eine Sache arroganter, im Zweifelsfall heuchlerischer Moralisierer?Jan-Werner Müller zeigt, wie und warum sich solche Vorstellungen nach dem Ende des Kalten Krieges entgegen allen Erwartungen liberaler Triumphalisten durchsetzten. Vor allem aber formuliert er auf den Spuren der in Deutschland immer noch weitgehend unbekannten Denkerin Judith Shklar einen Liberalismus, der sich an der ...
Der Liberalismus ist in Verruf geraten. Oft wird er nur noch als Elitenattitüde wahrgenommen, als exklusive Kultur urbaner Globalisierungsgewinner. Wie konnte es so weit kommen? War der Liberalismus schon immer eine Sache arroganter, im Zweifelsfall heuchlerischer Moralisierer?
Jan-Werner Müller zeigt, wie und warum sich solche Vorstellungen nach dem Ende des Kalten Krieges entgegen allen Erwartungen liberaler Triumphalisten durchsetzten. Vor allem aber formuliert er auf den Spuren der in Deutschland immer noch weitgehend unbekannten Denkerin Judith Shklar einen Liberalismus, der sich an der Vorstellung eines Lebens ohne Furcht und Abhängigkeiten orientiert. Damit wird es möglich, sowohl Antidiskriminierunsgpolitik als auch soziale Sicherung neu zu begründen - anstatt sie immer wieder unproduktiv gegeneinander auszuspielen.
Jan-Werner Müller zeigt, wie und warum sich solche Vorstellungen nach dem Ende des Kalten Krieges entgegen allen Erwartungen liberaler Triumphalisten durchsetzten. Vor allem aber formuliert er auf den Spuren der in Deutschland immer noch weitgehend unbekannten Denkerin Judith Shklar einen Liberalismus, der sich an der Vorstellung eines Lebens ohne Furcht und Abhängigkeiten orientiert. Damit wird es möglich, sowohl Antidiskriminierunsgpolitik als auch soziale Sicherung neu zu begründen - anstatt sie immer wieder unproduktiv gegeneinander auszuspielen.