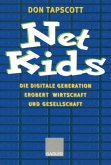Jaron Lanier, der den Begriff der "virtuellen Realität" erfunden hat, stellt in seinem neuen Buch dar, wie das World Wide Web die Individualität jedes einzelnen von uns bedroht, vermindert oder gar zerstört.Wie kein zweiter hat Jaron Lanier die revolutionären Veränderungen vorausgesagt, die mit dem Internet einhergehen und die alle Aspekte unseres Lebens betreffen: Arbeit und Freizeit, Handel und Wandel, Kommunikation und Sexualität, das kollektive wie das individuelle Leben. Wie kein zweiter warnt er vor den Gefahren des permanenten Online-Seins, vor dem Verlust an Subjektivität in der Anonymität des Netzes. Die eigene Intelligenz und das Urteil des einzelnen von Computeralgorrithmen bedroht. Technologisches Design, das File-Sharing, der Kult ums Facebook, die permanente Erreichbarkeit und oft filterlose Präsentation des Eigenen bedrohen die Kultur des Dialogs, der Eigenheit und Verborgenheit, aus denen die Individualität sich speist.Lanier zeigt die Bedrohungen in vielen Facetten auf und plädiert für einen neuen maßvollen Umgang mit dem Internet. Computer sollen, so sein leidenschaftliches Plädoyer, die Humanität verbessern, nicht ersetzen.Jaron Lanier gilt als Begründer der "virtuelle Realität" Technologie. Er lehrt als "Scholar at Large for Live Labs, Microsoft Corporation" in Berkeley, Kalifornien, und ist als Musiker und bildender Künstler international hervorgetreten. Seine Beiträge fanden auch in der deutschen Presse großes Echo. "Ein provozierendes, gewiss kontroverses Buch . . . Leuchtend, kraftvoll, und überzeugend." The New York Times"Poetisch und prophetisch . . . das wichtigste Buch des Jahres." The Times (London)

Wissen wir, wie wenig wir über das Internet wissen? Jaron Lanier warnt vor gefährlichen Entwicklungen und fordert die digitale Emanzipation.
Von Hubert Spiegel
Auf Seite 57 ist Schluss. Warum sollte man mit der Lektüre eines Buches fortfahren, dessen Autor von denkender Software und zum Leben erwachenden digitalen Superorganismen berichtet und dann auf Seite 57 allen Ernstes das Problem diskutiert, ob man eher Tintenfische, Hühner oder Ziegen in seinen persönlichen "Kreis der Empathie" einbeziehen sollte?
Der Autor dieses seltsam anmutenden Werks entwickelt zunächst eine erfreuliche klare Haltung. Er entscheidet sich gegen Hühner, diese "gefiederten, servogesteuerten Maschinen". Aber als habe er Angst vor der eigenen hühnerfeindlichen Courage bekommen, folgt sogleich der Rückzieher: "Andererseits empfindet einer meiner Kollegen, der virtual reality-Forscher Adrian Cheok, solche Empathie für Hühner, dass er Teleimmersionsanzüge für sie baute, damit er sie von seiner Arbeitsstätte aus telestreicheln konnte. Wir alle müssen mit unserer unvollkommenen Fähigkeit leben, die Grenzen unseres Empathiekreises in geeigneter Weise zu bestimmen."
Wer nicht bereits vor der Lektüre dieses Buches Zweifel an der Beschaffenheit seines persönlichen Empathiekreises hegte, dürfte spätestens an dieser Stelle die Neigung verspüren, das Buch in die Ecke zu pfeffern. Denkende Software? Hühner in Teleimmersionsanzügen? Das Internet als gottähnliches Lebewesen? Geht's noch?
Weil das Buch jetzt in der Ecke liegt, hat man Zeit, im Internet schnell mal nachzusehen, was ein Teleimmersionsanzug eigentlich ist (kein Treffer) oder ob ein empathiegeladener Telestreichler namens Cheok überhaupt existiert. Binnen Sekunden zeigt sich, dass Adrian Cheok zwei Professuren innehat, als Direktor dem Mixed Reality Lab der Universität von Singapur vorsteht und zehn computerwissenschaftlichen Fachzeitschriften als Herausgeber oder Beirat verbunden ist.
Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte eine solche Recherche großen Aufwand bedeutet. Ein junger Wissenschaftler, sei er Kybernetiker oder Altphilologe, ist in keinem Brockhaus verzeichnet. Man brauchte Bibliographien oder am besten den Bestandskatalog einer großen Universitätsbibliothek, um herauszufinden, ob ein Wissenschaftler existierte oder womöglich nur eine Erfindung war. Der vor wenigen Jahrzehnten undenkbare Vorgang der Internetrecherche ist uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben fast schon vergessen, wie die Welt ohne Internet aussah, aber sind noch nicht so weit, dass wir historische Romane zu diesem Thema lesen wollen. Sie werden geschrieben werden.
Wir wissen in der Regel nicht, wie das Internet funktioniert, können nicht beschreiben, wie es darin aussieht, und haben keine Ahnung, was mit uns passiert, wenn wir uns dort aufhalten. Vielleicht ist das Internet der fremdeste Ort auf unserem Planeten. Mit Sicherheit ist es der einzige fremde Ort, den wir betreten, ohne uns vorher zu fragen, was uns dort widerfahren könnte. Wenn wir vor die Aufgabe gestellt würden, eine Landkarte des Internets zu zeichnen, könnten die meistens von uns nichts zu Papier bringen und müssten die weiße Fläche mit jener Aufschrift versehen, die antike Kartographen benutzten, um unerforschte Länder und Erdteile zu kennzeichnen: Hic sunt leones.
Jaron Lanier ist ein Ureinwohner des Internets und sein Kartograph. Er ist Entdecker, Eroberer und Missionar, einer, der den ewigen Zug nach Westen vorantreibt und zugleich vor den Folgen für die unberührte Landschaft warnt. Er hat den Begriff der "virtuellen Realität" geprägt und die ihr zugrundeliegende Technologie erweitert. Er ist ein ehemaliger Computer-Freak, der sich mitunter einen nostalgischen Rückblick auf seine Zeit als langhaariger Garagen-Nerd erlaubt, aber die meiste Zeit über den Blick in die Zukunft richtet. Aber es ist nicht nur leichter, sondern auch wichtiger zu sagen, was Jaron Lanier nicht ist: Er ist kein Maschinenstürmer, kein Computer-Saulus, der sich zum analogen Paulus gewandelt hätte, kein kulturkritischer Prophet und kein wollüstiger Apokalyptiker. Seine Warnungen sind weder schrill, noch werden sie genüsslich vorgetragen. Aber sie geben zu denken. Und das ist es auch, was Lanier erreichen will: Wir sollen lernen, über das Internet nachzudenken, bevor uns das Denken abgenommen wird.
Deshalb sollte man dieses Buch wieder aus der Ecke fischen, in die man es auf Seite 57 geworfen hatte. Lanier gibt sich zwar Mühe, es seinem Leser leicht zu machen, aber wer mit der digitalen Materie und dem üblichen Slang nicht vertraut ist, tut sich mitunter schwer. Die nicht selten holprige Übersetzung macht es auch nicht einfacher. Da muss man durch. Manches ist reichlich banal, anderes hochkompliziert. Aber auch das scheinbar Banale hat seinen Sinn. Warum singt Lanier so eifrig das Hohelied auf die Einzigartigkeit des Individuums? Weil er zu der Überzeugung gelangt ist, dass dieses Konzept in weiten Teilen der digitalen Welt etwa so hoch in Kurs steht wie in China zu Zeiten Maos, und weil er nicht möchte, dass es uns eines Tages ergeht, als wären wir ungebildete Bauern und Tagelöhner in den unendlichen Reisfeldern des World Wide Web.
Auch Fachchinesisch wird in diesem Buch nur selten ohne Grund verwendet. Aber was fangen wir bloß mit der Information an, die besagt, dass es noch immer nicht gelungen ist, eine interaktive Web-Animation eines Hendekagons darzustellen? Der Hinweis, dass diese geometrische Figur einer doppelt extremen Version der berühmten Kleinschen Flasche ähnelt, hilft da auch nicht weiter.
Lanier bringt dieses Beispiel in einem Kapitel, dass die Beschränkungen von Wikipedia zum Thema hat. Ein Grundpfeiler von Wikipedia ist die Überzeugung, dass das Kollektiv der Wahrheit immer näher kommt als der Einzelne. Lanier macht die Probe aufs Exempel am Beispiel der härtesten unter den harten Wissenschaften, der Mathematik. Aber es geht ihm nicht darum, Wikipedia Lücken nachzuweisen. Lanier fragt stets nach den zugrundeliegenden Prinzipien einer Sache, präpariert sie heraus und denkt im nächsten Schritt darüber nach, welche Folgen auftreten könnten, wenn diese Prinzipien sich ausdehnen, auf andere Bereiche überspringen oder verallgemeinert würden.
Die Marginalisierung der Einzelstimme und die Vergötzung des Kollektivs, die mit dem Konzept der Schwarm-Intelligenz einhergeht, führt ins Zentrum dieses Buches. Lanier sagt zunächst, was jeder weiß: dass individuelle Freiheit und Kreativität an gewisse Rahmenbedingungen geknüpft sind. Dann beschreibt er, was kaum jemand sieht: wie diese Rahmenbedingungen durch das Internet einem dramatischen Wandel unterworfen sind.
An den Beispielen von Facebook, der Musik- und der Filmindustrie, der Finanzwirtschaft, der Zeitungsverlage oder des Wissenschaftsbetriebs skizziert Lanier die Folgen des "digitalen Maoismus", vor dessen Vormarsch er warnt. Die Geringschätzung von geistiger Urheberschaft, die Diktatur der Gratiskultur, die als kultureller Fortschritt verklärt wird, obwohl sie auf individueller Kreativität beruhende Lebensentwürfe drastisch beschränkt oder unmöglich macht, die Kommerzialisierung der sozialen Netzwerke, die offenbar im Begriff stehen, zu gigantischen Kundendateien zu pervertieren - Lanier zeigt an vielfältigen Beispielen, welche Gefahren von einem Internet ausgehen können, das als frei und offen idealisiert wird, aber Kräften unterliegt, die von ideologischen, technologischen oder ökonomischen Motiven getrieben sind. Er bezeichnet Weichenstellungen in der Vergangenheit und verweist auf Wegmarken, die noch vor uns liegen.
Lanier versammelt die Anzeichen dafür, dass ein "kybernetischer Totalitarismus" dazu führen könnte, dass das Internet aufhört, ein Instrument zu sein, das den Menschen dient. Schon heute bedarf es größter Anstrengungen, sich der Tributpflicht zu entziehen: Den kommunikativen Druck, den das Internet aufbaut, bekommt auch der zu spüren, der nicht zum Ziel einer Hetzjagd in der Blogosphäre geworden ist. Vor der Lektüre dieses Buches erscheinen Laniers Forderungen banal. Ja, natürlich sollte der Mensch sich nicht Maschinen gegenüber als inferior fühlen. Unser Selbstwertgefühl in der realen Welt darf sich nicht aus der fiktiven Idealausgabe unserer selbst speisen, die wir in sozialen Netzwerken präsentieren. Wir dürfen die Entwicklungen, die das Internet durchläuft, nicht als unabänderlich betrachten. Es gibt kein Naturgesetz, das besagt, wie sich das Netz entwickelt und wie diese Entwicklung unser Leben beeinflusst. Aber versteht sich all dies nicht von selbst?
Nach der Lektüre weiß man, dass die Antwort auf diese Frage nein lautet. Es versteht sich nicht von selbst. Laniers Aufruf für einen "digitalen Humanismus" ist ein Aufruf zur digitalen Emanzipation. Ist dieses mitunter recht eigentümliche Buch das Dokument der Konversion eines amerikanischen Digital-Avantgardisten zur alteuropäischen Geistestradition? Man mag Laniers Rückgriff auf die Kategorien des Humanismus am Beginn des 21. Jahrhunderts für naiv halten, aber er ist bestimmt nicht einmal halb so naiv wie unser aller alltäglicher Umgang mit dem Netz.
Jaron Lanier: "Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht." Aus dem Englischen von Michael Bischoff. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 247 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Bernd Graff lässt keinen Zweifel an seinem Respekt für den Computerguru und Medienliebling Jaron Lanier aufkommen: Eloquent, intelligent und in seinem Nachdenken über die Internet- und Computerwelt absolut kompetent sei der Autor, der in den 80er Jahren den Begriff von der "virtuellen Realität" geprägt hatte. In seinem neuen Buch "Gadget" nun, das Mitte Oktober erscheint, warnt der Autor eindrücklich vor dem Verlust des souveränen Individuums und der authentischen Kommunikation und hält ein emphatisches "Plädoyer für einen neuen Gesellschaftsvertrag" zu deren Schutz, teilt der Rezensent mit. Mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für einen "digitalen Humanismus", der sich dem grassierenden "Hive Mind", einer plappernden "Schwarmintelligenz", wirksam entgegensetzt, sieht Graff dann aber doch so etwas wie eine Überreaktion. So "schlimm" ist es doch gar nicht, beschwichtigt der Rezensent, der Laniers Pessimismus hinsichtlich der Kommunikation im Web nicht teilt und meint, dass doch auch im Netz noch echte Menschen sich miteinander austauschen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Laniers Kritik ist die Kritik eines Individualisten, der mit Grauen sieht, wie die Buntheit der Existenzen in einige wenige Standards gepresst wird. Nichtsdestotrotz bringt Lanier seine Leser zum Nachdenken über den eigenen Umgang mit dem Medium Internet. Und die Lektüre seines Buches lohnt allein schon wegen des reichen Hintergrundwissens des Autors.«
Matthias Eckoldt, Deutschlandfunk 14.02.2011
Matthias Eckoldt, Deutschlandfunk 14.02.2011