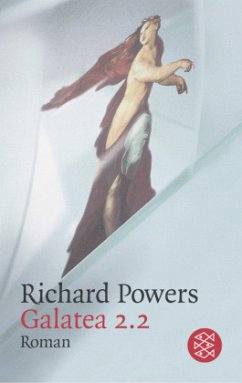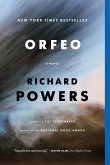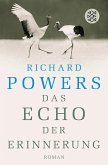Ein hochaktueller Roman über Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz, der den Kopf beschäftigt und das Herz bewegt
Richard Powers erzählt die Geschichte einer Wette: Kann ein Computer in zehn Monaten die Magisterprüfung in Englisch ablegen? Zwei Computerwissenschaftler treten gegeneinander an und machen einen Schriftsteller zum Coach der vernetzten Systeme, die eine Stimme und einen Namen erhalten. Doch als die Maschine fragt, was Liebe ist, macht der Coach einen Fehler und verstrickt sich in eine Affäre.
Richard Powers erzählt die Geschichte einer Wette: Kann ein Computer in zehn Monaten die Magisterprüfung in Englisch ablegen? Zwei Computerwissenschaftler treten gegeneinander an und machen einen Schriftsteller zum Coach der vernetzten Systeme, die eine Stimme und einen Namen erhalten. Doch als die Maschine fragt, was Liebe ist, macht der Coach einen Fehler und verstrickt sich in eine Affäre.

Richard Powers durchstreift die arrogante Welt der Prozessoren
Der Schriftsteller Richard Powers hat ein Problem. An der Mitte des Lebens und am Ende seines neuesten Romans angelangt, den er selber nicht für wirklich gelungen hält, zerfällt ihm unversehens seine Existenz unter den Händen, etwas, das der heutigen langlebigen Sorte des Homo sapiens sehr häufig widerfährt, wenn man der Belletristik Glauben schenkt. Er streift des Abends ziellos durch die geisterhaften Korridore der Universität U. und im Internet durch die ganze Welt, "eine weitere totale Desorientierung, die zum Status quo wurde, ohne daß jemand es merkte". In dieser verdüsterten Phase erscheint es wie eine Rettung oder doch zumindest Linderung der Wirrsal, daß er mit Doktor Lentz bekannt wird, einer der merkwürdigen Figuren, die die Universität von U. bevölkern, an der Powers, als writer in residence, noch einige Monate abzusitzen hat.
Doktor Philip Lentz, Fachmann für "Kognitionsökonomie mit Hilfe neuronaler Netze", hat eine Idee, wie der Schriftsteller sich nützlich machen könnte: nämlich beim Programmieren einer gigantischen künstlichen Intelligenz. Diese, ein körperloser, auf die verschiedenen Großrechner der Uni verteilter Frankenstein, soll - so die Vorgabe - am Ende des Studienjahres so weit sein, das Abschlußex amen in Englischer Literatur zu schaffen. Dazu genügt es nicht, ihn mit allen Texten des Kanons und allen möglichen Antworten auf mögliche Prüfungsfragen zu füttern, nein: Das "Implement H", das der Schriftsteller dann nach einiger Zeit des gegenseitigen Kennenlernens auf den Namen Helen tauft, muß mit einer quasinatürlichen Intelligenz, also einer Art von Weltverständnis, ausgestattet werden. Nicht nur gestaltet sich dies komplizierter als gedacht, sondern Helens verständnisloses Fragen nach der Liebe bringt den Schriftsteller dazu, seine mehrere Jahre währende und schließlich im Unglück geendete Liebesbeziehung zu der Holländerin C. nach und nach in Rückblenden Revue passieren zu lassen. Er macht das einerseits für Helen, damit "sie" vielleicht besser versteht, was die Figuren umtreibt, denen sie bei ihrer "Lektüre" begegnet, andererseits um selber Klarheit zu bekommen über sein fünfunddreißigjähriges, trotz literarischer Erfolge irgendwie unerfreulich verlaufenes Leben.
So bestechend die Erzählidee auf den ersten Blick wirkt, als so unfruchtbar erweist sie sich letztlich. Die Vermählung zwischen der hoch-, ja postmodernen High-Tech-Szenerie der Naturwissenschaftler, die sich, um an das Ziel ihrer Träume zu gelangen, am Ende wieder mit der Geisteswissenschaft einlassen müssen, und den eigentlich schlichten biographischen Verstrickungen des Ich-Erzählers will nicht gelingen. Die Welt der höchstentwickelten Elektronik bleibt unanschaulich, und es stellt sich beinah derselbe Effekt wie bei der Lektüre eines üblichen Computerhandbuchs ein: Es ist ausschließlich davon die Rede, wie die Maschine funktioniert, niemals davon, daß sie nämlich zwischendurch nicht funktioniert. Mit der Lässigkeit des durchtrainierten Computerfreaks führt der Autor uns durch die schillernde und arrogante Welt der Prozessoren, in der niemals das passiert, was dem gewöhnlichen Sterblichen andauernd widerfährt: daß auf dem Bildschirm etwa eine Botschaft erscheint wie: "Das Programm wurde unerwartet beendet, weil Fehler 57 aufgetreten ist", und man stundenlang seinem siechen Gerät Gesellschaft leistet, ohne drauf zu kommen, warum um alles in der Welt "Fehler 57" aufgetreten ist und was er sein könnte.
Der Klappentext bringt den Darstellungsanspruch des Romans auf die modische Formel: "Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verwischen sich." Dabei vermischt sich hier nichts, sondern es ereignet sich, was sich seit der Erfindung der ersten Maschine aller Zeiten ereignet: Die Grenzen innerhalb der jeweiligen Tätigkeit zwischen Mensch und Maschine verschieben sich, das neue Handwerkszeug kann mehr und anderes als das alte, aber vermischt oder verwechselbar sind wir mit dem Computer sowenig wie der Weber von 1810 mit seinem Webstuhl. Mit "Galatea 2.2" lesen wir einen Ideenroman, der es sich vornimmt, zentrale geistige Strömungen der Epoche abzuhandeln, und der im Endergebnis, bei aller Brillanz der einzelnen Passagen (die Werner Schmitz überzeugend ins Deutsche gebracht hat), nur den einen Fehler hat: Er fügt sich nicht zum Roman, zur Geschichte, die Teile bleiben unverbunden nebeneinander stehen. Da hilft es auch nicht, daß der Text mit defätistischen Formulierungen wie "Gewäsch, so unlösbar wie die Intelligenz selbst" oder "die Welt hatte genug Romane" durchwirkt ist, die sich leicht gegen den Roman wenden, den man gerade liest. WALTER KLIER
Richard Powers: "Galatea 2.2" Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Werner Schmitz. Ammann Verlag, Zürich 1997. 460 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main