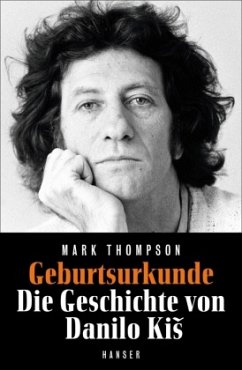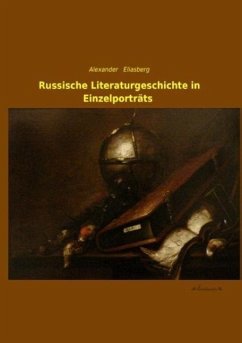Einige Jahre vor seinem Tod hat Danilo Kis auf wenigen Seiten einen Abriss seines Lebens geschrieben, dem er den Titel "Geburtsurkunde" gab. Der Osteuropakenner Mark Thompson nimmt diesen Text auf virtuose Weise als Vorlage für seine fundierte und vorzüglich lesbare Biografie des Schriftstellers. Sein Buch erzählt nicht nur das Leben von Danilo Kis, sondern ist zugleich eine Werkbiographie und vermittelt den besonderen Zusammenhang von Geschichte und Literatur in Mittel- und Osteuropa. "Mark Thompsons Kompetenz auf diesem Gebiet ist atemberaubend." (Adam Zagajewski)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Danilo Kis schrieb seinen Vater aus Auschwitz heraus, hinein in eine lange Zugfahrt. Über einen Mann, der billige literarische Siege immer scheute, und seine ewige Suche nach dem eigenen Vater.
Von Michael Martens
Die Lieblingsfarbe seiner Mutter war Grün, und sein Vater wollte nach Nicaragua. Später starb die Mutter an Krebs, und der Vater wurde an einem schönen Sommertag nach Auschwitz deportiert. Der Sohn hatte die Mutter geliebt, aber seine Erinnerung kreiste lebenslang um den Vater: Eduard Mendel Kohn, geboren 1889 in Ungarn. Herr Kohn nahm später den ungarischen Namen Kis an und wurde Eisenbahnbeamter - anfangs in Österreich-Ungarn und dann, weil Reiche weichen und nur Gleise bleiben, in Jugoslawien. Der Beamte Kis wurde mehrfach befördert und war schließlich Oberinspektor bei den jugoslawischen Eisenbahnen. Ansonsten: schwieriger Mensch. Versank im Herbst in Depressionen, aus denen er im Frühjahr nur erwachte, um sich mit einer Mischung aus Sonnenlicht und Alkohol zu betäuben. Ließ sich nach dem Weltkrieg in Subotica nieder, das in einem Pariser Vorort per friedensvertraglichem Federstrich von einer südungarischen Stadt an der Grenze zu Serbien in eine nordserbische Stadt an der Grenze zu Ungarn verwandelt worden war. Lernte in dieser Stadt in der Vojvodina Milica Dragicevic kennen, eine Montenegrinerin, hochgewachsen und schön wie viele Frauen aus dem Land der schwarzen Berge. Als er ihr begegnete, reiste Eisenbahnoberinspektor Kis bereits mit einem schweren seelischen Triebwerksschaden durchs Leben, trank zu viel und hatte in Nervenheilanstalten vergeblich Hilfe gesucht. Und doch muss etwas an ihm gewesen sein, das Milica Dragicevic lieben zu können glaubte, denn sie heiratete diesen fast schon Entgleisten, der mehr als 13 Jahre älter war als sie. Die Ehe war von Beginn an schwierig. Mehrfach wurde Eduard Kis als Folge seiner Trunksucht in psychiatrische Anstalten eingewiesen. Aber inmitten der üblichen Endlosschleife aus Suff, Verzweiflung und guten Vorsätzen muss es auch Lichtblicke gegeben haben, denn Eduard und Milica Kis bekamen eine Tochter und einen Sohn. "Danilo, männlich, Jude" steht im Geburtenregister Suboticas über den am 22. Februar 1935 zur Welt gekommenen Sohn.
In dessen drittem Lebensjahr erschien der von Eduard Kis herausgegebene "Jugoslawische und internationale Fahrplan für die Jahre 1938-1939" (Novi Sad, 148 Seiten), der alle Zug-, Bus-, Fähr- und Flugverbindungen auflistete, die in Jugoslawien begannen oder endeten. Als Pendler zwischen Flasche und Heilanstalt hinterließ Eduard Kis mit diesem Werk die einzige öffentlich greifbare Spur seines traurigen Lebens, um einige Jahre danach für immer zu verschwinden. Der Sohn wird diesen Fahrplan später zu einem Welterklärungsbuch mythologisieren. Immer wieder taucht das Werk des Vaters in dem des Sohnes auf, umgedeutet zu einer universalen Lebensschrift, dessen Verfasser bei dem Versuch, die schnellste Verbindung von der Vojvodina nach Nicaragua zu ermitteln, mehr als 200 Lexika zu Rate gezogen und sich unheilbar mit Länder- und Städtenamen infiziert habe, wie Danilo Kis schrieb.
Danilo Kis, der Sohn: Wenn wir uns einen Fußballer vorstellen, von dem Pelé, Beckenbauer, Maradona und Ronaldo sagen, er sei der Größte gewesen, den aber kaum jemand kennt - dann sind wir nah dran an dem Phänomen Danilo Kis. Kis war nicht annähernd so berühmt wie viele seiner Leser, Bewunderer und Förderer: Michel Houellebecq, Salman Rushdie, Milan Kundera, Bernard-Henri Lévy, Joseph Brodsky, Susan Sontag, Philip Roth, Nadine Gordimer. "Es gibt bessere Geschichtenerzähler als Danilo, aber keinen, der stilistisch besser wäre", sagte Brodsky, und von Melinda Nadj Abonji, Gewinnerin des deutschen Buchpreises 2010, stammt der Satz: "Ich war irritiert, als ich die Schönheit von Danilo Kis entdeckt habe."
So geht es vielen, denn Kis beherrschte sein Lebensthema mit souveräner Meisterschaft. Das 20. Jahrhundert war für ihn ein Jahrhundert der Lager, und Kis beschäftigte sich immer wieder mit der Frage, was all die Vernichtungsstätten zwischen Magadan und Buchenwald in den Menschen angerichtet hatten, in Opfern, Tätern, Davongekommenen, Beteiligten und Passanten des Grauens. Dabei blickte er als Dichter fast nie in die Lager hinein. Er musste nicht in die Folterkeller hinabsteigen, um deren Schrecken zu beschreiben. Kis veranschaulicht das Unvorstellbare, indem er über die lebenslangen Traumata der Angehörigen jener Menschen schreibt, die in den Vernichtungsfabriken umkamen. In tausend Umwegen und Annäherungen schrieb er auf diese Weise immer wieder auch über seine eigenen Wunden. Nein, sein Vater sei nicht in Auschwitz gestorben, sagte Kis beharrlich. Er sei dort "verschwunden". Bei Kis ist der Vater nicht deportiert worden, sondern einfach eines Tages mit dem Zug gefahren und nicht zurückgekehrt, so wie andere nach Chicago auswandern und dort als Streichholzfabrikanten reich werden. Kis schreibt über seinen Vater wie über einen entfernten Verwandten auf einem anderen Kontinent, über den man zwar wenig weiß, der aber zweifellos noch lebt und webt und manchmal ein Stück Schokolade isst. Kis' Geschichten beginnen jäh und enden abrupt, aber die Fragen, mit denen sie den Leser alleinlassen, bohren, hämmern und feilen noch lange danach im Hirn. In seinem Roman "Garten, Asche" beschreibt Kis einen Stoffbeutel an einer Klowand, vollgestopft mit Ausschnitten aus Zeitungen und Illustrierten, mit lauter Reportagen über "Filmdiven und Wiener Grafen, Protagonisten skandalöser Affären und Vamps, berühmte Jäger und Entdecker, Helden der Ostfront und ruhmreiche deutsche Flieger", deren Abenteuer nun, in handliche Größen zurechtgeschnitten oder im Wortsinne aus dem Zusammenhang gerissen, den hygienischen Bedürfnissen der Toilettenbenutzer dienen. Kis' kindlicher Erzähler ist fasziniert von diesen Texten - nicht obwohl, sondern gerade weil sie so unvermittelt einsetzen und mit einer Plötzlichkeit enden, die seine Phantasie auf Tage hinaus beschäftigen. Mitten im Satz beginnend, willkürlich endend, die Neugierde des Lesers nicht befriedigend, sondern steigernd: So wie diese zum Kotabwischen verwendeten Zeitungsausrisse sah Kis das Leben, und so wollte er darüber schreiben.
Das Schicksal seines Vaters lieferte ihm den Stoff dafür. Im Januar 1942 ermordeten ungarische Soldaten und Gendarmen im von Ungarn besetzten Novi Sad, wo die Familie Kis inzwischen lebte, als "Sühne" für jugoslawische Partisanenüberfälle in wenigen Tagen mehr als 1200 serbische und jüdische Zivilisten. Eduard Kis, der seine Kinder schon 1939 in weiser Voraussicht in Novi Sad auf die orthodoxe Religion seiner Frau hatte taufen lassen, überlebt das Massaker nur mit Glück. Die Kis verlassen Novi Sad und ziehen in das ungarische Heimatdorf des Vaters, wo man sicherer zu sein hofft. Doch der Umzug in die Provinz ist nur von aufschiebender Wirkung für die Tragödie, die über die ohnehin unglückliche Familie hereinbrechen wird. In einem Interview berichtete Kis einmal von dem Moment, als sein Vater den gelben Stern, den seine Mutter auf ihrer Singer-Maschine selbst genäht hatte, erstmals anprobierte, so wie Kunden eines Herrenausstatters sich im Spiegel mit einem neuen Jackett betrachten. Passt das Gelb zur Krawatte? Steht mir mein Stern? Eine makabre Szene, aus der andere einen Roman oder mindestens eine Erzählung gemacht hätten. Kis nicht. Als er gefragt wurde, warum er diese Erinnerung in seiner Prosa nirgends beschrieben habe, antwortete er: "Weil sie mir zu stark, zu pathetisch erschien, wie übrigens viele andere Szenen auch, für die ich kein ironisches Gegengewicht fand, das sie hätte neutralisieren können." Kis scheute allzu offensichtliche Bilder und billige literarische Siege. Die Schoa wird bei ihm nicht durch direkte Schilderung banalisiert, sie zieht sich nur als Ahnung, Schatten, Echo, Spiegelbild durch seine Texte. Das Ergebnis gerät umso eindrucksvoller. Der britische Historiker Mark Thompson, der nach jahrzehntelanger Herkulesarbeit eine eindrucksvoll recherchierte und erzählte und nun auch auf Deutsch erschienene Lebensgeschichte Kis' vorgelegt hat, schreibt dazu: "Als Schriftsteller hat Kis seine Verwandten nie in die Todeslager begleitet. (. . .) Kis folgt nicht einmal seinem Vater im Januar 1942 ans Ufer der Donau, wo dieser während des Massakers von Novi Sad nur knapp dem Tod entkommt." Statt zu beschreiben, wie der Vater den hausgemachten Judenstern anprobiert, sehen wir ihn bei Kis, wie er sich nach einer seiner Sauftouren, den frischen Stern am Leibe, auf dem Weg nach Hause in einem Sonnenblumenfeld verirrt. "Er ging wie ein Schlafwandler, immer seinem Stern nach, der sich zwischen den Sonnenblumen verlor, und erst am Feldrand fand er ihn wieder - an seinem schwarzen, speckigen Gehrock."
Wenn Kis die vielen schlechten Eigenschaften seines alkoholkranken Vaters - Wutanfälle, Anmaßung, Disziplinlosigkeit, Selbstsucht - so ausführlich beschreibt, dann nicht um der banalen Einsicht willen, dass es unter den in Auschwitz Getöteten natürlich auch böse, egoistische und schlechte Menschen gab. Er setzt die Schwächen seines Vaters als ästhetisches Kontrastmittel ein, um dessen Figur umso kraftvoller zeichnen zu können. Eine literarische "Idealisierung der Opfer" lehnte Kis stets ab. "Wenn ein Buch nur deshalb gelesen wird, weil es von Schwarzen, Juden, Homosexuellen oder, mit Verlaub, Frauen berichtet, dann interessiert mich ein solches Buch absolut nicht", beschrieb er sein Literaturverständnis.
In den besten Momenten sind aus diesem Verständnis Texte entstanden, die niemand vergisst, der sie las. Immer wieder geht es dabei um einen Sohn, der in der Einbildung lebt, sein Vater könne Auschwitz (das kaum je beim Namen genannt wird) irgendwie überlebt haben. So war es in Wirklichkeit natürlich nicht: Im Juli 1944 fuhr der vormalige Eisenbahninspektor Eduard Kis, geborener Kohn, ein letztes Mal Zug. In "Garten, Asche" schreibt sein Sohn zwei Jahrzehnte später: "Daraufhin ließ er einige Jahre überhaupt nichts von sich hören, jegliche Spur von ihm hatte sich verwischt. (. . .) So vergehen manchmal auch zwei, drei Jahre ohne ein Lebenszeichen von ihm, dann wieder meldet er sich (. . .). Er kommt manchmal als Handlungsreisender verkleidet, als westdeutscher Tourist in Reithosen, wobei er so tut, als verstünde er kein einziges Wort unserer Sprache." Der Vater war längst eine Wolke über polnischem Himmel, als die von seinem Sohn in die Spur gesetzten Romanfiguren ihn noch immer in fremden Männern wiederzufinden hoffen: "Das letzte Mal kam er vor zwei Jahren an der Spitze einer Delegation ehemaliger Lagerhäftlinge, die Auschwitz und Buchenwald überlebt hatten. Er sollte einen Gedenkvortrag halten. Doch als ich ihm auf der Straße begegnete und folgte, zog er sich in sein Hotel zurück und versteckte sich am Tresen, wo er Kaffee mit Schlagsahne bestellte." Im Hotel, "mit einem zweifellos gespielten fremdländischen Akzent", fragt der vermeintliche Vater den Vatersucher: ",Welche Gründe haben Sie, junger Mann, zu behaupten, gerade ich sei Ihr verehrter Herr Vater?'" Doch der Sohn lässt nicht locker: "Je mehr er sich mir entzog, desto mehr bestand ich darauf, ihn zu finden und zu entmystifizieren." Immer wieder schickt Danilo Kis seine Erzähler auf eine zum Scheitern verurteilte, für die Leser aber beeindruckende Vatersuche.
So subtil Kis beim Schreiben war, so handfest konnte er politische Debatten führen. Als er 1973 seine Lektorentätigkeit an der Universität Bordeaux antrat, trug er noch die Wunden einer Belgrader Wirtshausschlägerei im Gesicht, was nicht ohne Wirkung auf seine Studenten blieb. Kis war ein Charismatiker. Frank Schirrmacher hat ihn persönlich erlebt und davon berichtet. Das war im Mai 1988 in Lissabon, auf einer Schriftstellerkonferenz, wo Kis in einen Streit geriet mit Tatjana Tolstaja (jawohl, eine Enkelin von), die beklagt hatte, in der von Kis für sich beanspruchten "mitteleuropäischen Identität" schwinge ein latenter "Antirussismus" mit. Kis wurde böse und sagte, er fühle sich wie ein Kleinkind, das man belehren wolle. Er mutmaßte gar, aus Tolstajas Worten spräche "die Anwesenheit der Sowjetarmee in Europa". Bei Schirrmacher liest sich das so: "Kis sprach von dem ,pädagogischen Ton der Russen', von dem Gefühl, man habe ihm ,die Leviten lesen wollen'. Das sind psychologisch höchst aufschlussreiche Bemerkungen, und sie zeigen, wie unbekannt dieses neuartige Phänomen noch immer für Mitteleuropäer ist: mit den Sowjets auf gleicher Stufe zu diskutieren."
Da hatte Schirrmacher noch 16 Jahre und Kis 17 Monate zu leben. Kis wohnte seit 1979 in Paris, verbrachte die Sommer aber immer in Belgrad. Im August 1989, als sein eigener Tod schon selbstgewiss in seiner Lunge nistete und sich auf die große Siegesfeier vorbereitete, starb eine Freundin von ihm, eine Belgrader Theaterlegende von üppiger Körperfülle. Für die Belgrader Zeitung "Politika" schrieb Kis einen lyrischen Nachruf. Dieser letzte zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Text, literarisch kein großer Wurf, lässt sich als Vorwort eines bereits schwer gezeichneten Menschen auf den eigenen Tod lesen: "Gut gemacht, Tod, was für eine Leistung - solch eine Festung zu vernichten! So viel Fleisch zu verschlingen, Knochen zu zermalmen, in so kurzer Zeit. So viel Energie zu verbrauchen, in gerade mal einer Zigarettenlänge, so schnell. Was für eine Leistung, Tod, was für eine Machtdemonstration. (Als hätten wir dir nicht auch so aufs Wort geglaubt.)"
Zwei Monate später hielt der Tod auch bei Kis Wort. Kis war seit seiner Jugend Kettenraucher gewesen, es gibt kaum ein Foto ohne Zigarette von ihm, doch er war überzeugt davon, er habe sich den Lungenkrebs im Wortsinne selbst zugeschrieben. Kurz vor Ausbruch der Krankheit hatte er nämlich eine Geschichte über einen Krebskranken verfasst. So etwas denke man sich nicht ungestraft aus, sagte Kis, als die Ärzte den Tumor entdeckt hatten. Er war 54, als er starb, genauso alt wie sein Vater zum Zeitpunkt von dessen "Verschwinden". Danilo Kis, der Atheist und fromme Abergläubige, wird das kaum als Zufall betrachtet haben. Sein Biograph Mark Thompson hat dazu einen Satz geschrieben, der als Grabinschrift geeignet gewesen wäre: "Er hatte abergläubischen Respekt vor dem gedruckten Wort und dessen Macht, der Welt zu schaden."
Mark Thompson: "Geburtsurkunde. Die Geschichte von Danilo Kis". Hanser, 512 Seiten, 29,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Mark Thompson hat Maßstäbe gesetzt, wie man den biographischen, zeit- und literaturgeschichtlichen Hintergrund eines literarischen Werkes darstellen und erzählen kann, ohne dass es dabei seine Einzigartigkeit verliert." Cornelius Hell, ORF - Ex libris, 03.05.15 "Diese Biografie ist neben einer fulminanten Kulturgeschichte auch eine eindrucksvolle literarische Lektion." Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung, 04.05.15 "Wohlinformierte, originell komponierte Biografie." Karl-Markus Gauss, Neue Zürcher Zeitung, 14.03.15 "Mark Thompsons Meisterwerk der Biografik bringt uns einen wiederzuentdeckenden Autor nahe." Wolfgang Schneider, Der Tagesspiegel, 11.03.15 "Eine beeindruckende Biografie." Brgitte von Kann, Deutschlandfunk, 05.03.15 "Ein erstaunliches Kaleidoskop-Porträt ..., klarer als eine konventionell aufgebaute Biografie." Alexander Kluy, Der Standard, 20.02.15 "Mark Thompson hat Danilo Kis ein großartiges Denkmal gesetzt." Jochen Schimmang, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.07.13