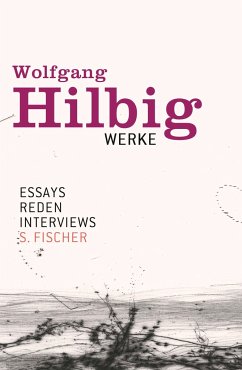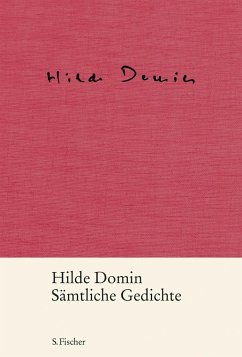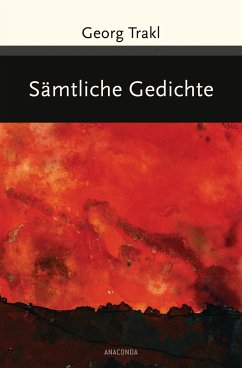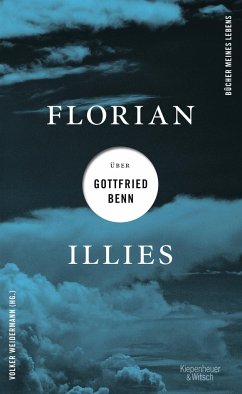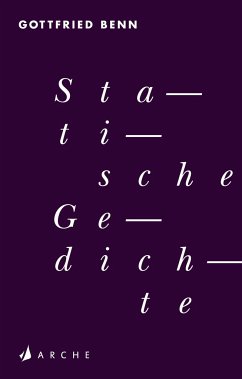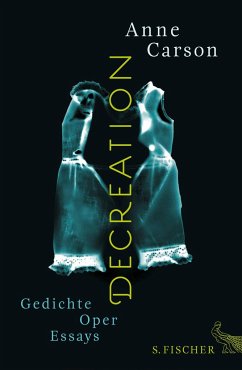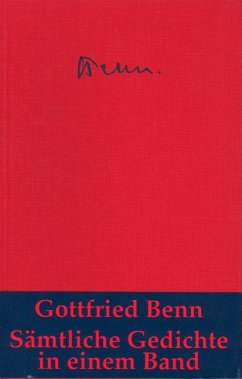Gedichte / Wolfgang Hilbig Werke Bd.1

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Als Wolfgang Hilbig am 2. Juni 2007 starb, verlor die deutschsprachige Literatur eine einzigartige Stimme. Bis zuletzt gelangen ihm Gedichte von dunkler, träumerischer Schönheit - sie waren der Anfang und das Ende seines Schreibens. Selbst in seinen großen Romanen war der lyrische Ton unüberhörbar. Ausgehend von den Traditionen der Romantik, des Symbolismus, des Expressionismus und geprägt von den Alltagserfahrungen eines Arbeiterlebens in der DDR, schuf er sich seine eigene Sprache: leidenschaftlich und voll brennender Sehnsucht, elegisch, grüblerisch, zärtlich. Es spricht ein Widerst...
Als Wolfgang Hilbig am 2. Juni 2007 starb, verlor die deutschsprachige Literatur eine einzigartige Stimme. Bis zuletzt gelangen ihm Gedichte von dunkler, träumerischer Schönheit - sie waren der Anfang und das Ende seines Schreibens. Selbst in seinen großen Romanen war der lyrische Ton unüberhörbar. Ausgehend von den Traditionen der Romantik, des Symbolismus, des Expressionismus und geprägt von den Alltagserfahrungen eines Arbeiterlebens in der DDR, schuf er sich seine eigene Sprache: leidenschaftlich und voll brennender Sehnsucht, elegisch, grüblerisch, zärtlich. Es spricht ein Widerständiger und Verletzter, ein »Traumverlorener, ein versprengter Paradiesgänger« (Süddeutsche Zeitung) - es spricht ein Dichter, ein Mensch.
als sie noch jung waren die winde
war ich verworren
und blind und taub
für ihren gesang
jetzt wenn ich das land durchstreife
und nicht mehr weiß
wo ich bin
und nichts mehr wissen will
in meinem herzen
denk ich an die winde
die alt geworden sind
Wolfgang Hilbig
als sie noch jung waren die winde
war ich verworren
und blind und taub
für ihren gesang
jetzt wenn ich das land durchstreife
und nicht mehr weiß
wo ich bin
und nichts mehr wissen will
in meinem herzen
denk ich an die winde
die alt geworden sind
Wolfgang Hilbig
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote