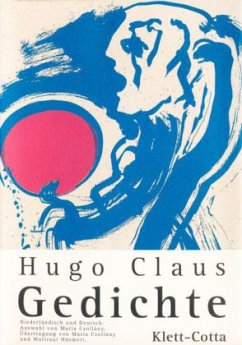Das Echo auf diese Gedichte ist im Niederländischen immer sehr stark gewesen, und faßt man die Einschätzungen zusammen, so ist ein rebellischer Vitalismus wohl das Hauptmerkmal dieser Poesie, der zugleich eine große thematische und formale Vielfalt zugeschrieben wird. Die literarische Moderne, Eliot und Pound, die Mythen der europäischen Tradition - das ist das Material dieser Gedichte. Der vorliegende Band, der die Texte nebeneinander in der Originalfassung und der Übertragung präsentiert, ist eine Auswahl aus dem lyrischen ?uvre von Claus, mit dem Autor zusammen getroffen. Ein kenntnisreiches Nachwort gibt einen Überblick über die Entwicklung der Claus schen Lyrik und ihre Bedeutung in der niederländischen Gegenwartsliteratur.

Gedichte von Hugo Claus / Von Harald Hartung
Der über siebzigjährige Hugo Claus ist ein Autor von mehr als hundert Büchern. Aber eins davon hängt ihm an wie Günter Grass die Blechtrommel. Es ist dies "Het verdriet van België", "Der Kummer von Flandern" - ein Schelmenroman über die deutsche Okkupation. An dieser Fixierung auf den einen Geniestreich haben einige weitere erfolgreiche Romane - zuletzt "Bella Donna" und "Das Stillschweigen" - nichts zu ändern vermocht. Was nicht heißen muss, dass Claus, der ewige Nobelpreiskandidat, in Stockholm nicht doch noch zum Zuge kommt.
Seit seinem Debüt mit achtzehn Jahren wirft Hugo Claus vulkanisch Feuer, Lava und Asche aus. Er tut das als ein furioses Multitalent auf allen erdenklichen Gebieten: als Autor von Romanen, Erzählungen, Gedichten, Theaterstücken, als Übersetzer von Seneca und Shakespeare, von Georg Büchner und Noël Coward. Claus ließ sich durch Artaud faszinieren und gehörte der Künstlergruppe Cobra an. Also malt und zeichnet er. Er macht Filme und inszeniert seine eigenen Stücke. Und das alles im Wechsel der Stile und Möglichkeiten und mit dem Vorsatz, das nächste Mal das Gegenteil des eben Gemachten zu versuchen. Ein Experimentator aus Temperament, nicht aus System. Die Register, die er zieht, scheinen unendlich, aber oft auch verwirrend.
"Registreren" lautet 1947 der Titel von Claus' Erstling, einem Band mit Gedichten. Wie bei Grass ist bei Claus die Lyrik der Quellpunkt seiner Inspiration. Dort erprobt er seine Themen und Motive. Dem Poeten ist dabei der Selbstausdruck seiner Vitalität wichtiger als die Vollendung der Form. Er ist Experimentierer, Selbstsucher und Selbstversucher, nicht Artist. Der Schub der Einfälle muss es bringen, nicht die Arbeit an Strophe und Vers. Wenn Claus auch seine Register wechselte und 1988 mit Sonetten überraschte - man darf das Bekenntnis ernst nehmen, das er in einem seiner späten Gedichte macht: "Zu stark zittert meine Hand. Ich will meine Literatur / nicht vervollkommnen." Das Zittern der Hand ist Koketterie, aber die Perhorreszierung der Perfektion mehr als bloß die Bedingung einer rastlosen Produktion. Hinter ihr stehen tiefere Motive. Am schlüssigsten kommen sie in einem Text aus seinen "Unfrommen Gebeten" zum Ausdruck. Dort lässt der Dichter Hekate sprechen, die hilfreiche und unheimliche Göttin, die Herrin von Zauberei und nächtlichem Unwesen: "Allein im Unvollkommenen / ich voll und dick. / Schönheit ist kein Gleichgewicht."
Diese Komponente grundiert alles, was Hugo Claus an Materialien zusammenbringt, ja zusammenrührt. Dass reicht von Vegetationsmythen zu sexuellen Kraftausdrücken, von Rekursen auf Volksromane zu Anspielungen auf populäre Seifenopern. Claus porträtiert Rubens und Rembrandt ebenso wie Lumumba, Italo Calvino oder eine anonyme Rundfunksprecherin. Er schreibt "Randgedichte" zu Dantes Inferno und liefert "Fünf Polaroidaufnahmen von Jesus Christus". Er möchte "Philosophen in ihrem philosophischen Hemd" in Brand stecken, doch wenn er sich in dem Zyklus, aus dem ich zitiere, als "Affe in Ephesus" geriert, dann ist er selber Philosoph, einer aus der Schule Epikurs. Ob Claus, der Büchner übersetzt hat und ihm in einem seiner Gedichte huldigt, in Dantons Sinn als gröberer oder feinerer Epikureer gelten soll, ist Sache des Lesers. Ist Sache auch der Auswahl.
Der zweisprachige Sammelband "Gedichte", mit Übertragungen von Maria Csollány und Waltraud Hüsmert, ist immerhin der zweite Versuch, den Lyriker Claus im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Voraus ging "Die Spuren", ein schmaler bibliophiler Band mit Gedichten und Zeichnungen (Kleinheinrich, Münster 1994). Dort lernte man einen harmonischen, fast klassisch beruhigten Hugo Claus kennen: Sei es, weil die Auswahl auf den Dichter selbst zurückging. Sei es, weil man eine Handvoll Sonette las, was für den späten Claus nicht ohne Bedeutung ist.
Auf diese Sonette, die sehr freie Transformationen von Sonetten Shakespeares sind, bezieht sich Hugo Brems in seinem informativen Nachwort zur neuen Sammelausgabe. Er belegt etwa, dass das vierzehnte der Claus'schen Sonette eine Montage zweier Shakespeare-Sonette ist und zugleich die trivialisierende Umkehrung ihrer Tendenz. Freilich findet sich das hier angesprochene und partiell zitierte Gedicht nicht im Textteil, wohl aber in der Auswahl bei Kleinheinrich. Auch zitiert Brems gelegentlich aus Gedichten, die deutsch überhaupt noch nicht in Buchform erschienen sind. Was man, wenn man will, als Bereicherung des Bandes auffassen kann.
Die beiden Übersetzerinnen, die ja nur durch Auswahl und Qualität des Übersetzten argumentieren können, setzen offenbar auf ein Gesamtbild, das auch den frühen, den ungebärdigen, kraftgenialen, den von Cobra beeinflussten Claus angemessen berücksichtigt. Von den Sonetten nehmen sie nur ein einziges auf. Brems wiederum zitiert, gleichsam gegenläufig, die Revokationen des alten Poeten, die selbstironisch mit dem Kult des Infantilen und Spontanen abrechnen. Das Gedicht "Cobra" endet mit den Zeilen: "Man malte weiter Vogelscheuchen / auf dem ansonsten verlassenen Spielplatz."
Das lyrische Werk von Hugo Claus ist also facettenreich genug, um solche Akzentuierungen nahe zu legen. Die Übersetzerinnen waren klug beraten, formal anspruchsvolle oder wegen des Reimzwangs heikle Stücke auszuschließen. Hugo Claus, der selbst eher lässig ist, gibt ihnen ein gewisses Recht dazu. Schade dennoch, dass mancher wunderbare Reim doch verloren geht. So wird in "Genesis 1,1" aus "en zocht in zijn hoorbare rede / naar een constructie voor roede en schede" das blass-korrekte: "Und suchte in seiner hörbaren Rede / nach einer Konstruktion für Rute und Scheide." Hier, im Schöpfungsakt, müssten sich auch die Dinge reimen.
Auch gibt es Stellen, die sich allzu nah ans Wörtliche halten, was wegen der vexierenden Nähe der beiden Sprachen problematisch ist. Warum heißt es "fragmentäres Gewicht" oder "Papier ist duldsam" statt geduldig? Diese Bemerkungen sollen das Verdienst dieser ersten umfassenden Präsentation des Dichters nicht schmälern. Sie ist eine interessante Mischung, eine Satura im klassischen Sinn. Etwas drastisch hat das ein jüngerer Dichterkollege von Hugo Claus ausgedrückt: Herman de Coninck schrieb, Claus bereite uns ein köstliches Gericht aus Trüffeln und Pferdeäpfeln. Guten Appetit. Freilich wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auf dem Teller lassen sich die einzelnen Bestandteile trennen. Anders als einem Restaurantbesucher sieht dem Leser dabei niemand zu.
Hugo Claus: "Gedichte". Ausgewählt und übertragen von Maria Csollány und Waltraud Hüsmert. Mit einem Nachwort von Hugo Brems. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2000. 212 S., geb. 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Der über siebzigjährige niederländische Autor, der seit Jahren als Nobelpreis-verdächtig gilt, wird hier ein zweitesmal in deutscher Übersetzung als Lyriker vorgestellt, diesmal weniger "klassisch-beruhigt" (wie im Band "Die Spuren" von 1994) als "ungebärdig, kraftgenial", schreibt Harald Hartung. Er berichtet zudem über das "furiose Multitalent" eines Mannes, der in allen literarischen Sparten zu Hause ist, außerdem noch Filme gedreht, übersetzt, inszeniert und als Mitglied der Künstlergruppe "Cobra" auch gemalt und gezeichnet hat. Die neue Übersetzung wird von Hartung nicht durchgängig gelobt, dennoch ist er hocherfreut über den Band, in dessen "informativem Nachwort" von Hugo Brems der Leser viel Zusätzliches über den Autor und sein Werk erfährt.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"