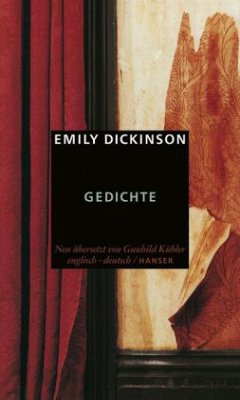Sie ist eine der berühmtesten angelsächsischen Dichterinnen. Emily Dickinsons unerschrockene Herzenserforschung, ihr zauberspruchhafter Ton und ihr sprachlicher Eigensinn sind einzigartig. Weltweit werden ihre Verse, obwohl schon 150 Jahre alt, zu Recht als moderne Lyrik gelesen. Diese erste repräsentative deutsche Dickinson-Ausgabe bringt - zweisprachig - mehr als 600 Gedichte in neuer Übersetzung und eröffnet überraschende neue Sichtweisen auf die amerikanische Dichterin, die in Deutschland bisher als Geheimtipp galt.

Sie wollte immer nur leise singen: Die große amerikanische Dichterin Emily Dickinson offenbart sich in Gedichten und Briefen
Bei der Teilung der Welt hat Gott die Dichter bekanntlich vergessen, aber nicht ihr Bedürfnis nach Ruhm. Spätestens die Moderne gab sich mit dem Lorbeer nicht zufrieden. Sie etablierte den Markt und das Karrierekalkül. Baudelaires "Blumen des Bösen" sollten die Blumen der Romantik verdrängen. Walt Whitman war ein Meister der Selbstreklame. Er schätzte den künftigen Jahresbedarf an seinen Gedichten auf zehn- bis zwanzigtausend Exemplare. Einen Erfolgsstreik dagegen vermag man sich kaum vorzustellen. Und doch gibt es ein Beispiel: Amerikas größte Dichterin. Was Amerika und was die Welt noch nicht gar zu lange weiß. Denn Emily Dickinson (1830 bis 1886) tat fast alles, um dem Ruhm zu entgehen. "Wir wußten noch nicht einmal, daß sie da war", sagte der Lyriker Robert Frost in einem Interview - das immerhin noch im Jahre 1960. Und fügte von oben herab hinzu: "Armes kleines Ding."
Geboren zu einer Zeit, als Goethe noch lebte, wuchs Emily Dickinson in die aufkommende Moderne hinein. Als sie zwanzig war, erschienen die Gedichte Edgar Allan Poes, fünf Jahre später, 1855, Walt Whitmans "Grashalme": Amerikas Durchbruch in die lyrische Moderne. Emily Dickinson - in jeder Beziehung Whitmans Gegenpol - hätte in dieser Entwicklung eine bedeutende Rolle spielen können. Doch sie übte Abstinenz, verzichtete auf Veröffentlichung. Dabei hatte sie - nach Bildung und Begabung - das Zeug zu Karriere und Ruhm.
Emily Dickinson wurde am 10. Dezember 1830 in Amherst in Neuengland geboren. Ihr Großvater war einer der Gründer des renommierten Amherst College, ihr Vater dessen Finanzverwalter. Emilys Schul- und Collegebildung war umfassend und schloß die Naturwissenschaften sowie Latein und Deutsch ein. Die häusliche Bibliothek war groß und ergiebig. Der Vater-Patriarch schenkte der Tochter Bücher, wollte aber nicht, daß sie las. Daß sie selbst Gedichte schrieb, wußte sie vor ihm zu verbergen. Er hielt nichts von schreibenden Frauen, aß jedoch einzig das von ihr gebackene Brot. Es muß vorzüglich gewesen sein, denn Emily wurde dafür mit einem Preis ausgezeichnet. Ihr einziger Preis war kein Literaturpreis.
Mit Hund Carlo
unterwegs in der Natur
Als junges Mädchen muß Emily überaus witzig und übermütig gewesen sein und den üblichen Freundschaften und Schwärmereien zugetan. Danach fand sie sich auf ihr eingezogenes Familiendasein verwiesen und blieb unverheiratet. Der Hund Carlo begleitete sie sechzehn Jahre auf ihren Spaziergängen. Später litt sie an einem chronischen Augenleiden, verließ das Haus immer seltener und empfing kaum noch Besuche. Zuletzt kommunizierte sie lediglich durch den Spalt ihrer angelehnten Zimmertür.
Die Stadt klatschte über die menschenscheue, stets weiß gekleidete Frau mit dem rotbraunen Haar. Sie hätte es noch mehr getan, wäre mehr über ihre Herzensbeziehungen bekanntgeworden. Über den Mann, den sie in den drei erhaltenen ernst-leidenschaftlichen Briefen ihren "Master" nennt; vermutlich der Reverend Charles Wadsworth, der sechzehn Jahre älter und verheiratet war. Oder über den Anwalt Otis Philipps Lord, mit dem die alternde Emily Dickinson Briefe wechselte, Liebesbriefe - witzig, verspielt und bemerkenswert offenherzig.
Emily Dickinson war eine passionierte Briefschreiberin. Alle ihre Briefe, auch ihre Liebesbriefe, waren ausgefeilt, manche sogar rhythmisiert. Die Grenze zwischen Epistel und Lyrik war fließend. Gedichte schrieb sie von Jugend an. Nur vier überlebten ein Autodafé der Achtundzwanzigjährigen. Ganze zehn wurden zu Emilys Lebzeiten gedruckt, ohne ihre Zustimmung und anonym. Von dem, was sie bis zu ihrem Tode schrieb, blieben fast achtzehnhundert Gedichte erhalten, etwa sechshundert als Beigabe zu ihren Briefen. Weitere achthundert fanden sich in vierzig "Fascicles", bescheidenen Manuskriptheftchen, die Emily aus Briefbögen zusammengenäht hatte. Späteres überließ sie dem mehr oder minder fertigen Zustand auf Briefumschlägen, Reklamezetteln und anderem Papier. Vieles fand sich in der Truhe einer verstorbenen Angestellten, darunter das einzige Porträtfoto Emilys, das der Familie nicht gefiel und eigentlich weggeworfen werden sollte.
Dennoch hätte es an Resonanz nicht fehlen müssen. Zwar hatte der vom Zeitgeschmack geprägte Literat Thomas W. Higginson ihr geraten, nicht vorschnell zu publizieren. Doch es gab zumindest eine Person von Einfluß, die Emilys Bedeutung erkannte - die gleichaltrige Schriftstellerin Helen Hunt Jackson. In einem Brief von 1875 beschwört sie Emily: "Sie sind eine große Dichterin - und Sie tun Ihrer Zeit damit ein großes Unrecht, daß Sie nicht laut singen wollen." Sie erreichte auf diese Weise immerhin, daß Emily Dickinsons "Success is counted sweetest" anonym in einer Anthologie erschien - und prompt Ralph Waldo Emerson zugeschrieben wurde.
Ausgerechnet dieses Gedicht formuliert die äußerste Skepsis gegen den Erfolg: "Erfolg schätzt der am meisten / Der niemals ihn errang. / Nur heftigstes Verlangen / Schafft solchen Göttertrank." Emily Dickinson muß die Versuchung, vom Nektar zu kosten, sehr wohl verspürt haben, um sie so rigoros abzulehnen. Denn der Besiegte - so die Schlußstrophe - vernimmt noch im Tode die fernen Klänge eines Triumphes, der nicht für sein Ohr bestimmt ist. Ein anderes Gedicht befindet lapidar: "Publizieren - heißt Versteigern / Eines Menschen Geist."
Ist das der Schlüssel für ihren Publikationsverzicht? Oder die Einsicht, daß ihre Lyrik dem Zeitgeschmack nicht entsprach? Oder die heiligmäßige Gleichgültigkeit gegenüber dem irdischen Schicksal ihrer Manuskripte? An Selbstbewußtsein fehlte es jedenfalls nicht. An den erwähnten Higginson schrieb sie: "Wäre der Ruhm mein, ich könnt' ihm nicht entkommen."
Welchen Pakt auch immer Emily Dickinson mit dem Schicksal geschlossen hatte - der Ruhm ereilte sie. Wenn auch postum und mit enormer Verzögerung durch einen jahrzehntelangen Erbschaftsstreit um den Nachlaß. Zwar gab es schon 1890, vier Jahre nach Emilys Tod, eine erste Auswahl ihrer Gedichte in Buchform. Jeder weitere Band brachte steigenden Ruhm, aber auch weitere editorische Verwirrungen. Nach Beilegung aller Streitigkeiten erschien erst 1955 eine vollständige Ausgabe, und die "Variorum Edition" von 1998 schließlich brachte eine plausible Chronologie der Gedichte und erledigte damit die Vorstellung, Emily Dickinson sei eine Dichterin ohne Entwicklung.
Nein, sie entsprang nicht fertig dem Haupt eines Zeus. Emily Dickinson hat sich ihren unverwechselbaren Stil erst erarbeitenn müssen. Sie sah sich nicht als Avantgardistin. Das Schlichteste an Tradition war ihr gerade recht. Sie wählte den simplen Reimvers des neuenglischen Kirchenlieds, rauhte ihn auf durch unreine Reime, zerklüftete ihn durch Gedankenstriche und erweiterte ihn durch rhythmische Kühnheiten. Sie liebte die Kürze und verglich das Dichten mit dem Auspressen ätherischer Öle. Sie verzichtete auf Titel für ihre Gedichte und gewann damit Ambivalenzen und Vieldeutigkeiten. "Er klimpert auf der Seele dir", lautet ein Anfang. Doch wer ist der Spieler, der dem sprechenden Ich einen Schlag versetzt, es anschließend in eine Kutsche einlädt und mit ihm vor einem rätselhaften riesigen Haus hält? Ist es der Geliebte? Ist es Gott? Oder der Tod?
Diese Poesie ist erotisch und metaphysisch zugleich. Dennoch war Emily Dickinson, die das Kirchenlied adaptierte, keine christliche Dichterin. Sie bekannte, nie beten gelernt zu haben. Als 1850 im Zuge des Erweckungseifers eine Bekehrungswelle durch Amherst ging und auch Vater und Geschwister Glaubenszeugnisse ablegten, blieb sie die einzig "Unbekehrte". Sie beugte sich nicht, sie hatte die Poesie erwählt, und die war nicht christlich, sondern orphisch. Grund genug, sie gegen eine fromme Öffentlichkeit zurückzuhalten. 1856 vertraut sie einer Freundin an: "Wäre Gott in diesem Sommer hier gewesen und hätte gesehen, was ich sah - ich glaube, Er müßte sein Paradies für überflüssig halten . . ." Fast apodiktisch heißt es 1866 an Higginson: "Paradies bleibt disponibel. Ein jedweder wird Eden erben, ohngeachtet, was Adam verwirkt."
Solch unbußfertiger Paradiesglaube artikuliert sich beinah rabiat in einem Gedicht, das die Bibel einen alten, verstaubten Band nennt und dagegen "des Orpheus Predigt" setzt, weil diese Predigt in Bann schlägt, ohne zu verdammen. Auch sonst wirkt manches wie ein Vorklang von Rilkes Orpheus-Sonetten. Emily Dickinson hätte mit Rilke vom "Rühmen" sprechen können und mit Loerke und Lehmann vom Grünen Gott. Sie liebte Gottes "Feldversuch in Grün", sah die Natur aber auch als Spukhaus und antizipierte die moderne Einsamkeitserfahrung vor dem leeren Weltall.
Modern ist vor allem ihre Auffassung vom dichterischen Ich. Sie treibt das artistische Spiel mit Masken und Stimmen und sieht sich als bloße "Repräsentantin" ihrer Verse - das Ich jene "Persona", wie sie später in Pounds "Personae" oder in den Heteronymen Pessoas erscheint. Artistische Distanz gilt dem Gedicht als der "Blüte des Gehirns". Gottfried Benn hätte das goutiert.
Doch Emily Dickinson ist weit mehr als eine Lyrikerin für Lyriker. Sie ist auch eine große Liebende, aber das angesprochene mysteriöse Er führt zumeist eine schemenhafte Existenz. Das heißt aber auch, daß keine biographisch ausgeleuchteten Love-Stories uns den Blick auf die seelische Innenwelt verstellen. Wir müssen nicht spekulieren, welche Realität hinter den "Wild Nights" steht, die ein Gedicht von 1861 evoziert, sondern können uns der Melodie und dem Assoziationraum der Verse hingeben. Erfüllung im Gedicht fragt nicht nach Empirie:
Sturmnächte - Sturmnächte!
Wär ich bei dir
In solchen Sturmnächten
Schwelgten wir!
Wozu - noch Winde -
Das Herz ist im Port -
Fort mit dem Kompaß -
Die Karte fort!
Ein Boot in Eden -
Ach - das Meer!
Verankert sein - heut nacht -
In dir!
Die Übersetzerin und Herausgeberin des neuen Gedichtbands, Gunhild Kübler, faßt "Wild nights" als "Sturmnächte" und verändert leicht den Assoziationsraum. Die bisherigen Übersetzer wählten "Wilde Nächte" - und Uda Strätlings Briefauswahl nimmt diesen Gedichtanfang sogar als Titel, was vielleicht etwas zu weit gehende Erwartungen erzeugt. Wie auch immer. Wer Emily Dickinson liest oder übersetzt, sollte stets mit ihrem Möglichkeitssinn rechnen. "I dwell in possibility" heißt es in einem zentralen Gedicht: "Ich wohne in der Möglichkeit - / Und nicht im Prosahaus -." Erst die Fülle der Möglichkeiten läßt Wahrheit zu, und diese Wahrheit läßt sich nur "schräg" erfassen, im "Umkreisen" (circumference). Das kann man ruhig ein Credo nennen.
Die ganze Wahrheit der
Liebe im Gedicht
So sind auch ihre Liebesgedichte nicht Relikte innerer oder äußerer Affären, sondern verdanken sich dem Versuch, die ganze Wahrheit einzukreisen, einzuschließen. Diese Liebeslyrik kennt Liebesglück und -verlust, Brautstand und Einsamkeit, Beseligung und Verzweiflung, rauschhafte Hingabe und brutale Überwältigung. Liebe ist Fülle des Lebens, doch der Tod erscheint unweigerlich in ihrem Schatten - aber als galanter Freier. So weit Emily Dickinsons Gedicht in Leben und Tod ausgreift, das Paradies, das es erstrebt, ist immer als wirklich vorgestellt. Noch ein spätes 1882 geschriebenes Gedicht hält an dieser Vorstellung fest:
Elysium ist so weit weg
Wie's Zimmer nebenan
Wenn da ein Freund erwartet
Glück oder Untergang
Die angelsächsische Welt weiß längst, was sie am "Elysium" von Emily Dickinsons Lyrik hat. Im deutschen Sprachraum hingegen ist sie immer noch ein Geheimtip. Dabei hat es nicht an Versuchen gefehlt, das Paradies dieser Poesie zu uns herüberzutragen. Ich nenne drei: Paul Celan, der zehn Gedichte übertrug; Lola Gruenthal, die neben Gedichten auch einige Briefe brachte; Werner von Koppenfels, dem wir die bisher breiteste Auswahl verdanken.
Nun aber bietet Gunhild Kübler eine wahrhaft umfassende zweisprachige Ausgabe und kann sich dabei auf die erst jüngst gefundene chronologische Ordnung der Texte stützen. Sie übersetzt weniger eigenwillig als Celan, weniger gefällig als Gruenthal, weniger spröde als Koppenfels. Sie geht die Gedichte gewissermaßen beherzt an - und das im schönen Doppelsinn des Wortes. Sie kommt oft zu geschmeidigen und triftigen Lösungen; und auch in den diffizileren Fällen zeigt sich das Maß an übersetzerischer Erfahrung. "In Büchern lagern meine Kämpfe", eine Zeile, die wohl auch die Übersetzerin bestätigen könnte.
In den Briefen, so mag man ergänzen, öffnet sich die Lebenswelt der kleinen Dame in Weiß, äußert sich ihre faszinierende intellektuelle Physiognomie und ihre Menschlichkeit, die Nähe suchte und Distanz zu halten wußte. Uda Strätling hat aus 270 Briefzeugnissen "Ein Leben in Briefen" komponiert und mit einer Vita Emily Dickinsons und vielen Informationen über ihre Korrespondenzpartner versehen. "Heute ein Brief von Emily Dickinson" - eine solche Notiz zeigt, daß ihre Briefe für viele Empfänger besondere Ereignisse waren. Wie stark aber die Wirkung ihrer Person war, hat Higginson überliefert - zugleich mit einem porträthaften Snapshot.
Im düsteren Salon des väterlichen Hauses hört er "Schritte wie die eines trippelnden Kindes & schon glitt eine kleine, unscheinbare Frau herein mit gescheiteltem rötlichen Haar". Als er diesen Besuch resümiert, gesteht er ein: "Nie habe ich mit einem Menschen Zeit verbracht, der mich derart viel Kraft kostete. Ohne jede Berührung entkräftete sie mich." Wer die Gedichte und Briefe der großen amerikanischen Dichterin Emily Dickinson liest, macht die gegenteilige Erfahrung: er fühlt sich wunderbar gestärkt, befreit und erhoben.
Emily Dickinson: "Gedichte". Englisch und deutsch. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort von Gunhild Kübler. Hanser Verlag, München 2006. 576 S., geb., 45,- [Euro].
Emily Dickinson: "Wilde Nächte". Ein Leben in Briefen. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Uda Strätling. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006. 400 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensentin Iris Radisch findet es schwierig, die Kunst der Dichterin Emily Dickinson mit den richtigen Worten zu beschreiben. Am ehesten fühlt sie sich bei der Lektüre an den "Flügelschlag eines Schmetterlings" erinnert: "Man spürt zunächst gar nichts ... und plötzlich ist man erleuchtet", meint sie. Die Kritikerin zeigt sich beeindruckt von Dickinsons Lyrik: Zwar wirke mancher Text "unzugänglich", doch die Worte kämen wie "frisch getauft" daher und ließen den Leser den Sinn "erkennen wie ein Kind", das nichts Vergleichbares vorher gelesen oder gesehen hat. Lob zollt Radisch auch Gunhild Kübler, die die Auswahl der Texte und deren Neuübersetzung vorgenommen hat. Zum einen hält sie ihr Nachwort für "die beste deutschsprachige Einführung" in Dickinsons Werk, zum anderen gefallen ihr die zahlreichen "überraschenden Lösungen" in der Nachdichtung, für die sich Kübler anstelle einer wörtlichen Übersetzung entschieden hat. Allerdings gehe dabei auch ein wenig von Dickinsons Eigentümlichkeit verloren, vom "spröden und unversöhnlichen Gestus", der ohne Sentimentalitäten auskommt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH