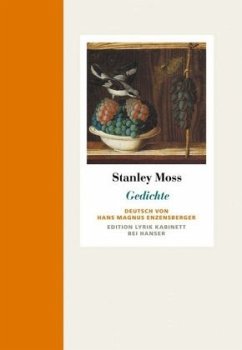Stanley Moss' Dichtung ist eine große Entdeckung. Der in Amerika und Europa geschulte Poet lehrt mit seinen großräumigen Gedichten das Staunen. Seine streunende Lust an den Dingen, an allem Unvollkommenen und Sterblichen kommt ohne Bitterkeit und ohne Zynismus aus. Darin liegt das Wunder, das uns seine Lyrik beschert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Weltgespräch der Poesie: Hans Magnus Enzensberger bringt uns die Gedichte des Amerikaners Stanley Moss. Es sind die Spaziergänge eines menschenfreundlichen Einzelgängers.
Von Jan Röhnert
Es ist nicht das erste Mal, dass wir Hans Magnus Enzensberger Entdeckungen aus Übersee verdanken. Was er aus dem Spanischen Süd-, mehr noch aus dem Englischen Nordamerikas nach Deutschland brachte, hat sich sowohl für sein eigenes Schreiben als auch für die Literaturgeschichte als fruchtbar erwiesen. Er war es, der Pound und Eliot im Museum der modernen Poesie vorstellte, er war es, der 1963 William Carlos Williams den Weg in die deutschsprachige Lyrik ebnete, und wiederum er, der dreißig Jahre später die Gedichte des New Yorker Versgenies Charles Simic übertrug und sich an Wallace Stevens' Picasso-Zyklus "The man with blue guitar" heranwagte.
Nun also der hierzulande noch unbekannte Stanley Moss: Gedichte, mit denen man sich an stürmischen Winterabenden verproviantieren und beschwingte Spaziergänge unternehmen möge - ohne einen Schritt vor die Tür setzen zu müssen. Das dürftige Wetter bleibt im Blick, aber man geht mit weit aufgespanntem Schirm hindurch: "Den kleinen Sumpf, / der in meinem Kopf wächst, / kann ich nicht vergessen. / Rotz, niedriger Vetter der Träne, / keines Kummers wert, / einziges unsrer Sekrete, / das mit Sex nichts gemein hat. / Keiner von meinen Lieben / hält viel von ihm und seinen Anstalten: / von Grippe, Asthma, gemeinem Schnupfen. / Obwohl ,du Rotzlöffel' auch bedeuten kann, / mein Lieber, mein Söhnchen. / Es ist etwas Schönes an ihm, / etwas Vertrautes wie am Gesicht / eines Freundes. Hunde fressen ihn. / Von ihm ist noch keiner reich geworden."
Diese Ode auf den "Rotz" kommt so respektlos wie elegant daher, als wäre sie Enzensbergersches Original. Da hat er also einen Geistesverwandten übersetzt, oder besser: uns die Poetik eines Geistesverwandten in seinem Duktus überbracht. Im Gedicht "Sag mir, meine Schöne" heißt es wie zur Legitimation: "Ich will nichts auswendig lernen, ich vergesse, / daß das Nervensystem des Menschen / das größte aller Gedichte ist. Das dauernde Hin und Her / von Erinnerung und Vergessen könnte ich inszenieren / als Komödie oder Tragödie."
Wer eigentlich ist nun dieser Stanley Moss? Wenig ist an Fakten nötig, seine Gedichte, ohne autobiographische Beichten zu sein, ziert eine unverwechselbar kosmopolitische Signatur, die wiederum der Enzensbergers ähnelt. 1925 geboren, studierte Moss in Dublin und Yale, war Englischlehrer in Barcelona und Rom, ist Inhaber einer Kunstgalerie und Verleger der Sheep Meadow Press. Von frühen Erfahrungen berichtet das von Raoul Schrott übersetzte "Tagebuch eines Satyrs": "Ich las ,Franco Franco Franco' auf einer Mauer in Malaga, ich ritt vor der Sphinx auf einem Kamel, tourte durch den Markusdom in Venedig, sah Männer an der Klagemauer beten . . . hörte das Echo meiner Hufe auf den grünen Teppichen und Fliesen der Hagia Sophia und der Blauen Moschee. Ich wurde mit den Karyatiden der Akropolis fotografiert . . . die griechische Sonne so hell auf dem weißen Marmor, daß meine Augen schmerzten."
In Gedichten wie dem von den "Gevatterinnen" namens "Womb und Mercy", die auf Hebräisch dasselbe bedeuten, oder auf den Bruder, der nach zwei Jahren Treblinka sich und anderen zur Flucht nach Palästina verhelfen konnte, oder auch dem "Gesang von den Alphabeten" schimmert die existentielle Konstellation von Moss hindurch: "Die hebräische Schrift an der Wand / hat nur einen Konsonanten, weil jeder Vokal, / Freud und Leid des Lebens selber weiß. Es gibt Worte, / mit meinem Blut geschrieben, die ich nicht lesen kann." Dann gibt es das fulminante sechsteilige Gedicht "Die Geschichte der Farben", das in der sinnlichen Vergegenwärtigung noch der exotischsten in der Malerei verwendeten Farbaufträge die Optik Newtons, beinah auch die Goethes alt aussehen lässt. Und da ist noch der Löwe des Hieronymus, der in der Wüste gegen Melancholie, gegen Tod anschreibt - ein Wappentier, das Moss durch mehrere Gedichte spazieren lässt, die burlesk und doch todernst von phantastischen Kehren der Weltgeschichte nicht nur in Nahost erzählen. Was wohl geschähe, wenn das Wort "Krieg" in allen Sprachen einen neuen Sinn erhielte, ist im Gedicht "Frieden" imaginiert.
Die Bibel sei Ursprache der Menschheit, hatte Herder vor 250 Jahren erklärt, im Reichtum ihrer Bilder und Geschichten lagere der Vorrat aller Poesie. Kein Wunder, wenn sich Moss noch heute einen "Brief an Noah" oder "Der Messias kommt nach Venedig" vorzustellen vermag. Mit neureligiöser Dämmerung hat das wenig, dafür viel mit dem Reiz poetischer Bilder zu tun: "In unserer neuen Gesellschaft sind all die alten Orden und Titel / der Religionen wie Eiskremsorten: Rabbis, Priester, Mullahs, Gurus / Buddhisten, Schiiten, Sunnis, Dominikaner, Kapuziner, / Franziskaner, Karmeliter - Eis am Stiel. Nie zuvor / standen den Kindern so viele Sorten zur Wahl, / nie zuvor waren die Zehn Gebote so kühl im Sommer", heißt es in bester Tradition einer Aufklärung, die alte Metaphern nicht auf den Müll wirft, sondern sie transformiert. Nicht umsonst ist das Gedicht, aus dem die Verse stammen, "Eine Erfrischung" überschrieben: Erkenntnisgewinn durch plötzliche Bild-Kongruenzen und den Einfallsreichtum sprachlicher Gesten, Sinnlichkeit statt Dogmatismus, nicht auf dem Katheder, sondern vom Leben und den Jahren geschult - das könnte als Devise über den Gedichten des Amerikaners Stanley Moss wie seines Übersetzers stehen.
Enzensbergers Verdeutschungen sind eloquent, voll idiomatischer Eleganz, ohne unnötige artistische Leuchtfeuer abbrennen zu müssen. Oft wirken die amerikanischen Verse seinem eignen Leben und Schreiben so verwandt, dass es scheint, Moss und er stünden miteinander in Dialog. In "Lenin, Gorki und ich" reist das poetische Alter Ego mit den Revolutionären durch Italien, delektiert sich an den Frauen, bis Lenin eine neue Doktrin ausgibt: ",Eine gute Bolschewikin erkennt ihr daran, / daß ihre Unterwäsche stets frisch ist.' // Damals habe ich Schluß gemacht mit der Partei . . . weil ich sie unbedingt anfassen, schmecken, / riechen musste, die Fraun von den Inseln am Golf von Neapel."
Bei allem Interesse am Weltverbessern lassen sich beide Dichter lieber von den Reizen einer physisch konkreten Welt verführen und preisen die Wolken, die Frösche, Kartoffeln oder vererben posthum ihre Hüte an Fernando Pessoa. Mehr als von Dogmen des Materialismus oder Lehrsätzen der Logik fühlen die Dichter sich zu den Widersprüchen der Empirie, zur Camouflage öffentlichkeitsscheuen Einzelgängertums hingezogen. "Ein Austausch von Hüten" ist ein Weltgespräch der Poesie, das Stanley Moss und Hans Magnus Enzensberger zu unsrem Vergnügen miteinander führen: "Ich vermache meine Sammlung von Hüten . . . / meinem lieben Fernando, der alle gewöhnliche Treue / in den Wind schlagend unter sieben Namen / in sieben Tonarten schrieb, ein Mann vieler Cafés . . . // Wer auf etwas versessen ist, so heißt es in Portugal, / der hat seine ,Illusion'. Er aber hielt es einfach nicht aus / mit seinem eigenen letzten Hut, vor einem Glas Portwein, / Zigaretten rauchend, Marke Ideal, im selben Café."
Stanley Moss: "Gedichte".
Aus dem Amerikanischen von Hans Magnus Enzensberger. Hanser Verlag, München 2010. 122 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Da haben sich zwei gefunden, jubelt Jan Röhnert, die wirklich zusammenpassen: der bislang hierzulande recht unbekannte amerikanische - aber sehr kosmopolitische - Lyriker Stanley Moss und sein deutscher Übersetzer Hans Magnus Enzensberger. Was den einen mit dem anderen verbinde, sei die Kombination von "Respektlosigkeit" und "Eleganz", auch die Faszination für die konkreten Dinge eher denn begriffliche Abstraktionen. Reich seien die Texte von Moss an biblischen Bezügen, Fernando Pessoa taucht als Schutzpatron auf, aber auch dem Rotz - "einziges unsrer Sekrete, / das mit Sex nichts gemein hat" - ist eines gewidmet. Das ganze also nach der festen Überzeugung des Rezensenten ein Fund, eine weitere gelungene Eingemeindung, von Enzensberger angeleitet und initiiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Enzensbergers Übersetzungen liefern das Pendant zu den Originalen - kongenial in ihrer Leichtigkeit, ihrer idiomatischen Eleganz, ohne artistische Leuchtfeuer abbrennen zu müssen." Jan Röhnert, Der Tagesspiegel, 30.08.10 "Weltgespräche der Poesie ... Die Spaziergänge eines menschenfreundlichen Einzelgängers." Jan Röhnert, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.01.11