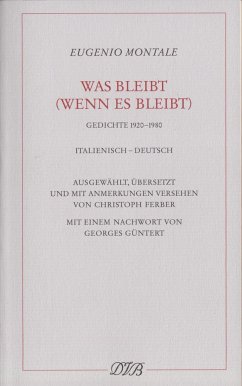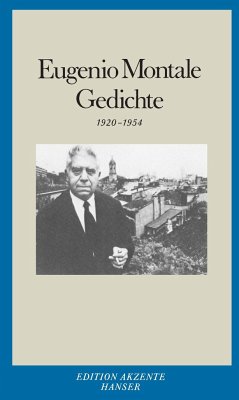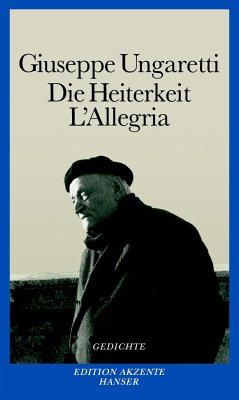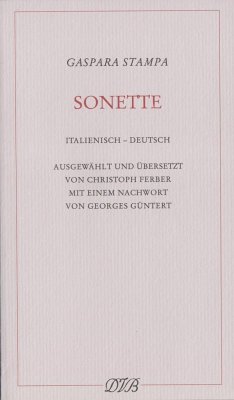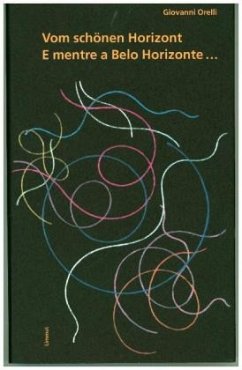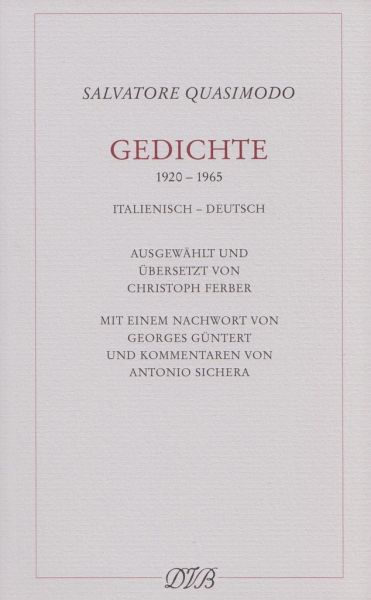
Gedichte
1920-1965. Italienisch - Deutsch
Mitarbeit: Güntert, Georges;Übersetzung: Ferber, Christoph
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das poetische Werk von Salvatore Quasimodo, der 1959 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, ist von zentraler Bedeutung für die italienische Dichtkunst der Moderne. In seinem Brotberuf jahrelang Landvermesser, hat Quasimodo auch das Feld der Sprache ausgelotet: Worte und Sätze, punktgenau gesetzt, formieren sich zu einer Textlandschaft, die in ihren Höhen, Weiten und Tiefen der menschlichen Existenzerfahrung ebenso einen Ort zuweist wie dem metaphorisch verdichteten Erleben von Natur und Geschichte. Die vorliegende repräsentative Gedichtauswahl gibt - in Gegenüberstellung von i...
Das poetische Werk von Salvatore Quasimodo, der 1959 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, ist von zentraler Bedeutung für die italienische Dichtkunst der Moderne. In seinem Brotberuf jahrelang Landvermesser, hat Quasimodo auch das Feld der Sprache ausgelotet: Worte und Sätze, punktgenau gesetzt, formieren sich zu einer Textlandschaft, die in ihren Höhen, Weiten und Tiefen der menschlichen Existenzerfahrung ebenso einen Ort zuweist wie dem metaphorisch verdichteten Erleben von Natur und Geschichte. Die vorliegende repräsentative Gedichtauswahl gibt - in Gegenüberstellung von italienischem Original und deutscher Übersetzung von Christoph Ferber - einen Querschnitt durch das zwischen 1920 und 1965 entstandene lyrische Oeuvre von Quasimodo; ca. die Hälfte der hier versammelten 110 Gedichte ist erstmals ins Deutsche übertragen worden. Kommentare zu den einzelnen Gedichten von Antonio Sichera, Dozent an der Universität Catania, und ein Nachwort des Zürcher Romanisten Georges Güntert ergänzen den Band.