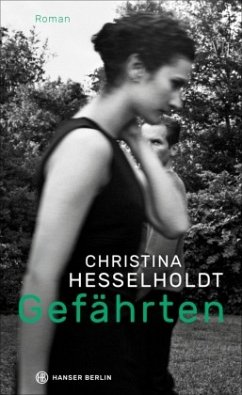Alma und Kristian, Camilla und Charles, Edward und Alwilda sind Jugendfreunde. Gemeinsam gehen sie jetzt durch die Phase des Lebens, die man die mittleren Jahre nennt. Herrlich schwerelos ziehen sie den Leser unmittelbar hinein in ihre Existenzen - ihre Leidenschaften, ihre Kümmernisse, ihre Sehnsüchte und Überempfindlichkeiten. Mit grandioser Beiläufigkeit und übermütiger Komik erzeugt Christina Hesselholdt dabei das Gefühl, dem Leben selbst nie näher gewesen zu sein als in den Lebensausschnitten dieser sechs Kopenhagener Freunde, die so radikal subjektiv, so befreiend offen über sich und ihre Beziehung zur Welt sprechen, über Liebe und Sex, Melancholie und Schmerz und das Glück der Freundschaft.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Kein Roman im eigentlichen Sinne: Die Dänin Christina Hesselholdt erzählt von den Sehnsüchten der gebildeten Mittelschicht
Sechs Personen haben hier eine Autorin gefunden: die seit langem befreundeten "Gefährten" Camilla und Charles, Alma und Christian, Edward und Alwilda. Ihre Autorin, Christina Hesselholdt, geboren 1962 im Norden von Kopenhagen, fing vor knapp dreißig Jahren mit wortkargen schmalen Büchern an (seinerzeit noch verheiratet mit Claus Beck-Nielsen, der sich dann selbst in ein Projekt verwandelte und kürzlich als Madame Nielsen den kleinen Roman "Der endlose Sommer" vorlegte; F.A.Z. vom 13. November 2018). Damals behandelte Hesselholdt in simpel gebauten Sätzen das zeitlose Thema der "Einsamkeit in der Zweisamkeit", wie ein Kritiker es nannte. Heute sind ihre Bücher nicht mehr ganz so asketisch und verdichtet wie damals, aber das Thema ist ähnlich geblieben.
"Gefährten" ist ihre erste Veröffentlichung auf Deutsch, der Band besteht aus vier Teilen, die in Dänemark von 2008 bis 2014 als selbständige Bücher erschienen sind. Dort nennt man den Zyklus "Camilla-Bücher"; Camilla ist Hesselholdts Alter Ego. Gegen Ende des Buchs zitiert diese Camilla den altgriechischen Philosophen Epikur: "Der Tod geht mich eigentlich nichts an. Denn wenn er ist, bin ich nicht mehr, und solange ich bin, ist er nicht." An der Stelle haben wir freilich längst erfahren, dass der Tod die handelnden oder sagen wir richtiger: redenden Personen sehr wohl etwas angeht. Er taucht schon am Anfang auf und lässt sie dann nicht mehr los. Das ewige "Kreisen um den Tod" geht vor allem Camilla selber auf den Nerv, zumindest weiß sie nach der Lektüre von V. S. Naipauls "Rätsel der Ankunft" endlich, woher es kommt: vom ständigen Umziehen und Verrücken der Möbel im Elternhaus, denn jeder Anfang trägt Zerstörung und Vergänglichkeit in sich.
Und doch ist der Tod nicht nur der reine Schrecken. Er hat auch eine schöne, ja sogar "graziöse" Seite. Düsenjäger, die über den Lake District jagen, die Landschaft des romantischen Dichters William Wordsworth, und die scheinbar das Gegenteil jeder Romantik sind, sie fliegen und wippen so verspielt und elegant, dass Alma, eine andere "Gefährtin", seufzt: "Von dem Moment an lebte und atmete ich dafür, noch einen Düsenjäger zu sehen oder am liebsten noch viele mehr." Was sich hier in den ersten Sätzen andeutet, wird im weiteren Verlauf immer deutlicher: die Abenteuerlust der Personen, die alle der gebildeten Mittelschicht angehören, ihre Suche nach einem Reiz, der ihr Dasein durchaus gefährden könnte. Sie möchten sich "vom Leben erobern lassen und den Abgrund spüren", sie sehnen sich nach etwas, "für das es sich zu sterben lohnt". Sie träumen von "unritterlichen" Begegnungen, davon, dass ein "unwiderstehlicher Mensch" ins Zimmer tritt. Diese Passage gehört in den zweiten Teil, wurde also 2010 geschrieben, aber heute gelesen, in Zeiten des Me-Too-Aktivismus, hat sie plötzlich eine hübsche Ironie. So oder so - Almas Geständnis "Ich wünschte, ich hätte ein kühnes Leben" spricht hier jeder der Personen aus dem Herzen.
Die Suche nach dem Abenteuer zieht noch weitere amüsante Szenen nach sich wie den Ausflug in eine Berliner Nachtbar. Camilla und Charles steigen in eine "dunkel lockende Welt" hinab, in der man die bürgerlichen Konventionen eine Zeitlang über Bord werfen kann. Einer verblüfften rumänischen Animierdame, die eben noch ihre Meinung über Herta Müller kundtun sollte, bietet Camilla den eigenen Mann an: "Er fickt wie ein Hengst." Camilla hat eine flotte Umgangssprache mit leichtem Slang und oft ironischem Understatement, was die Übersetzerin gut getroffen hat. Doch so schlicht wie Camillas Werbeslogan für ihren Mann ist das Buch normalerweise nicht, die Sätze sind meistens länger, manchmal von ergreifender Schönheit und absolut nicht manieristisch. Es ist eine reife, in sich ruhende Prosa. Auch die vielen Zitate und Rückversicherungen bei berühmten Autoren wie Wordsworth, Emily Brontë, Virginia Woolf oder Thomas Bernhard, den unverrückbaren Klassikern, sind kein bloßes Namedropping, sondern eher Illustration eines Lebensgefühls, Zeugnis eigener Leseerfahrung.
Das Erzählen einer Geschichte ist Hesselholdts Anliegen nicht. "Gefährten" ist kein Roman im eigentlichen Sinne, sondern ein Episodenstück, das überwiegend aus inneren Monologen besteht (am erzählerischsten ist der dritte Teil). Diese sechs Personen geben im Stillen einen Rechenschaftsbericht vor sich selbst ab, ihre Gedankenverlorenheit wirkt dabei wie ein unerlässlicher menschlicher Wesenszug. Sie sinnen über alte Liebschaften nach, über das Scheitern ihrer Ehe, den Verlust naher Menschen, über Träume, die trösten und zerstören können. Für den Muttertod fängt man sogar an zu schreiben: Edward hat sein "Tagebuch der Trauer" und Camilla ihr Notizbuch, das sie "Dokument schwarz" nennt. Da sitzt sie am Ende, nach dem Tod der Mutter und der Trennung von Charles, allein in ihrem geerbten Sommerhaus, lässt sich von einem polnischen Gärtner übers Ohr hauen, vergleicht sich mit einem Igel, liebäugelt mit Thomas Bernhards Gedanken "Nähe würde ihn umbringen" und "spuckt all das gewesene Elend in diesen Eimer", damit meint sie ihr Notizbuch. Sie schildert ein Familienschicksal voll früher Tode und Selbstmordversuche, mit Alkoholismus, Schizophrenie und Depression - Camilla ist "die Einzige in der Familie, die nie krank ist".
Es ist eine Geschichte, manchmal mit Längen, bei der man sich fragt, ob sich die Autorin hier freischreibt, indem sie über andere (aber natürlich am meisten über sich selbst) notiert, und zwar mit "schlechtem Gewissen" (wie Camilla über sich sagt). Vielleicht auch freischreibt von der Abenteuerlust oder den hohen Ansprüchen an eine Beziehung. Sie zitiert John Bayley, den Mann der alzheimerkranken Iris Murdoch: "Wir waren zusammen, weil uns die Einsamkeit, die jeder im andern sah und erkannte, tröstete und beruhigte." Das ist ein demütiges, aber auch ermunterndes Wort zum Schluss.
PETER URBAN-HALLE
Christina Hesselholdt:
"Gefährten".
Aus dem Dänischen von
Ursel Allenstein. Hanser
Berlin Verlag, Berlin 2018. 446 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main