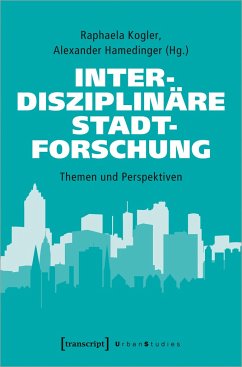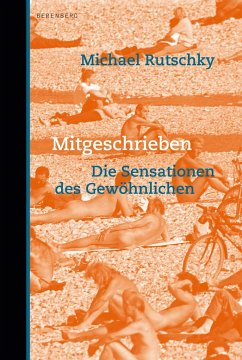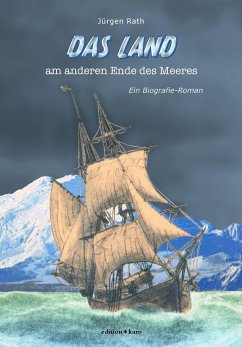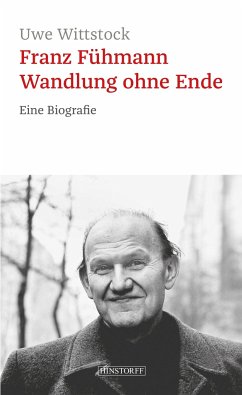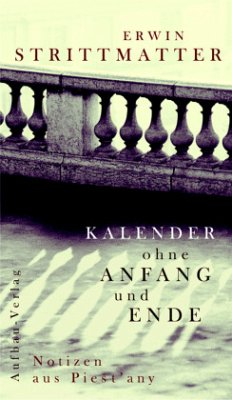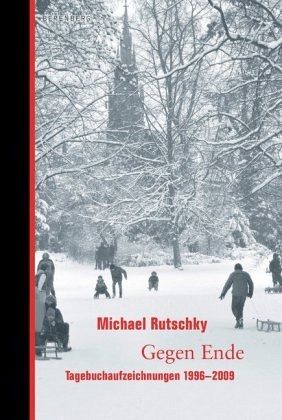
Michael Rutschky
Gebundenes Buch
Gegen Ende
Tagebuchaufzeichnungen 1996-2009
Herausgegeben: Scheel, Kurt;Mitarbeit: Scheel, Kurt; Lau, Jörg
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





So wie Michael Rutschky als der intellektuelle Coach einer ganzen Publizistengeneration galt, so (selbst-) ironische ist er mit dieser Rolle umgesprungen. In diesen noch von ihm selbst und seinem Freund Kurt Scheel ausgewählten Tagebuchnotizen aus der Zeit des beginnenden Alters ist diese Selbstdistanz zum Thema geworden, für eines der letzten - komischen und un-komischen - Kapitel seines Lebensromans. Hier hat Rutschky seine intellektuell hoch gerüstete Umgebung durchleuchtet, Freunde, Feinde und zufällig durchs Objektiv laufende Gestalten und Landschaften. Vor allem aber er selbst und se...
So wie Michael Rutschky als der intellektuelle Coach einer ganzen Publizistengeneration galt, so (selbst-) ironische ist er mit dieser Rolle umgesprungen. In diesen noch von ihm selbst und seinem Freund Kurt Scheel ausgewählten Tagebuchnotizen aus der Zeit des beginnenden Alters ist diese Selbstdistanz zum Thema geworden, für eines der letzten - komischen und un-komischen - Kapitel seines Lebensromans. Hier hat Rutschky seine intellektuell hoch gerüstete Umgebung durchleuchtet, Freunde, Feinde und zufällig durchs Objektiv laufende Gestalten und Landschaften. Vor allem aber er selbst und seine Ehe werden mit den Kontrasten des auf die Berliner und Kreuzberger Umgebung schrumpfenden Alltags belichtet. Die Lektüre dieser wie gewohnt virtuos lakonischen Prosa dürfte nicht nur für Fans dieses Autors milde ausgedrückt überraschend sein.
Michael Rutschky, geboren 1943 in Berlin, starb im März 2018. Seine Tagebücher "Mitgeschrieben" (2015) und "In die neue Zeit" (2017) sind bei Berenberg erschienen.
Produktbeschreibung
- Verlag: Berenberg Verlag GmbH
- Seitenzahl: 360
- Erscheinungstermin: 1. März 2019
- Deutsch
- Abmessung: 187mm x 139mm x 26mm
- Gewicht: 434g
- ISBN-13: 9783946334491
- ISBN-10: 3946334490
- Artikelnr.: 54585219
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.2019Wo Ich war, soll Es werden
Einübung in das Verschwinden: Über den dritten Band der Tagebücher Michael Rutschkys
Ein Jahr nach seinem Tod liegt unter dem Titel "Gegen Ende" der dritte Band der Tagebücher Michael Rutschkys vor. Der Titel ist Zeitangabe und Aufbegehren, gibt Vorgeschmack auf die Lektüre gemischter Gefühle. Vom Aufbruch in eine neue Zeit ist nicht mehr die Rede. Das "Mitgeschrieben" des Diaristen weicht in den Jahren von 1996 bis 2009 einer Haltung, die den Erfahrungshunger des Essayisten auf ein Protokoll des eigenen Verfalls und die Nöte seiner Ehefrau lenkt.
Vor einigen Jahren grub die Redaktion des "Merkurs" eine Fernsehdiskussion aus dem Jahr 1981 aus, in der der junge Rutschky, noch
Einübung in das Verschwinden: Über den dritten Band der Tagebücher Michael Rutschkys
Ein Jahr nach seinem Tod liegt unter dem Titel "Gegen Ende" der dritte Band der Tagebücher Michael Rutschkys vor. Der Titel ist Zeitangabe und Aufbegehren, gibt Vorgeschmack auf die Lektüre gemischter Gefühle. Vom Aufbruch in eine neue Zeit ist nicht mehr die Rede. Das "Mitgeschrieben" des Diaristen weicht in den Jahren von 1996 bis 2009 einer Haltung, die den Erfahrungshunger des Essayisten auf ein Protokoll des eigenen Verfalls und die Nöte seiner Ehefrau lenkt.
Vor einigen Jahren grub die Redaktion des "Merkurs" eine Fernsehdiskussion aus dem Jahr 1981 aus, in der der junge Rutschky, noch
Mehr anzeigen
keine 40, mit Erwin K. Scheuch und Karl Heinz Bohrer über Jugendkrawalle in London sprach. Am Rand waren auch noch der NDR-Royal Rolf Seelmann-Eggebert und der sehr junge Diedrich Diederichsen beteiligt. Beim Wiedersehen war, dreißig Jahre nach dem Geschehen, zu beobachten, wie ein politischer Konflikt, das Aufbegehren einer Jugend, die nichts mit Theorie am Hut hatte, zum Gegenstand einer hellsichtigen Diskussion werden konnte.
In den Charlottenburger Räumen des "Merkurs" sprang Quarto, der junge Hund Rutschkys, herum, zeigte hündischen Erfahrungshunger, indem er aufgeregt aus dem Fenster spähte. Hätte ein Spatz auf dem Sims gesessen, es wäre um Scheibe, Hund und Vogel geschehen gewesen. Keine Intervention des "Herrchens", als das sich Rutschky gegenüber seinen Hunden auch nie verstand. Er ließ dem Hund seinen Lauf und, gleichmütig, psychoanalytisch geerdet, die damalige Diskussion Revue passieren. Er zeigte, wie sich Aufregung durch Kühle anders erfassen lässt. Der junge Rutschky, gewiss ein Linker, zeigte keinen Enthusiasmus für Formate neuer Klassenkämpfe im Urururgroßmutterland des Kapitalismus. Der junge wie der alte wirkten wie ein Seismograph, der Phänomene des Gleichzeitigen beobachtet, Mikro-Pegelausschläge notiert, ohne Ehrgeiz für vorschnelle Erklärungen, aber mit großer Liebe für beobachtbare Details.
Zu Beginn des dritten Bandes seiner Aufzeichnungen ist der Diarist längst ein etablierter Public Intellectual in den besten frühen Jahren seines sechsten Jahrzehnts. Von der ersten Seite an aber durchzieht ein Ton das Buch, der bei Rutschky überrascht. "Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden", das ist ein Actus-Tragicus-Ton, der vom Totengesicht der Mutter Rutschkys über die todgeweihte Katze in Zeitlupe nach dem hohen Paar der West-Berliner Intellektuellenszene zu greifen beginnt.
Bei der Buchpremiere im Literaturhaus lesen Wegbegleiter und Freunde aus den Tagebüchern, der Erbe Jörg Lau erinnert an eigene Irritationen und die des Rutschky-Freundes und Herausgebers Kurt Scheel. An die Stirnseite des Raumes werden Fotos projiziert, in Großaufnahme eine Doppelseite der Tagebücher. Sie zeigt eine gleichmäßige, aus der Ferne halbwegs lesbar wirkende Handschrift, mit Füller geschrieben, der Schreibfluss weder durch Korrekturen noch durch Nachträge unterbrochen, das Werk eines Routiniers. Wie wählt er aus, was er notiert, was nicht? Mit Füller kann man nicht so schnell schreiben wie mit einer Tastatur. Die langsame Bewegung der Feder in der Hand formt im Notat Einträge, die den Charakter von Urteilen gewinnen, gegen die es keine Berufung gibt. Wer wollte mit welchem Recht Einspruch erheben? Wogegen? Gegen die Beobachtung eines dicken Hinterns, gegen die Geldsorgen der Ehefrau, gegen die minutiöse Schilderung ihrer Schreibprobleme? Der Tagebuchschreiber entscheidet, bevor er zum Schreiben ansetzt, was vom vergangenen Tag zum Thema wird. Je weiter die Lektüre fortschreitet, desto unausweichlicher der Eindruck, dass ihm oft Bosheit die Feder führt.
Schon im ersten Band der Tagebücher bemerkt der junge Rutschky mit seltsamer Genugtuung, dass gleichaltrige oder jüngere Männer um ihre Hüften zulegten, während sein männlicher Leib noch hinreichend fest wirkte. Der männliche Leib findet im dritten Band tiefere Aufmerksamkeit. Sie fräst sich aus den Träumen in Tagträume und offenes Begehren. Rutschky liefert mit diesen Einträgen ein spätes Coming-out. Der soignierte ältere Herr verwandelt sich in einen Wiedergänger Gustav von Aschenbachs. Das wirkt bei einem Autor, der durch die eigene Psychoanalyse und sein essayistisches Werk so viel mitzuteilen und zu beobachten gegeben hat, wie eine reverse operation, jetzt wird die Spule zurückgedreht, als hieße die Devise dafür: Wo Ich war, soll Es werden. Minutiös beschreibt er Fotografien, die ihn vor dem Spiegel zeigen, und autoerotische Fotografien, die den spät aufblühenden Narzissmus technisch erzählbar machen. Aus dem Freundeskreis schildert er eine Männerbeziehung, bei der er im Unklaren lässt, ob sie für ihn ein Rollenmodell sein könnte.
Mit äußerster Diskretion, im Tonfall resolut bitter, beschreibt er einen anderen Sachverhalt, der sich wie das Protokoll einer Kränkung lesen lässt. In den Zeitraum von 1996 bis 2009 fallen zwei Gastaufenthalte Rutschkys, einer in Heidelberg, ein anderer in Bamberg. Einflussreiche Freunde werden namentlich erwähnt, die sich für ihn hätten einsetzen können. Warum aber, in Dreiteufelsnamen!, hat keine namhafte deutsche Stiftung, kein geistes- oder sozialwissenschaftlicher Fachbereich Rutschky zu einer Sinecure-Professur für die Neuerfindung eines Studium generale verholfen? Der Bolognese-Verflachung der Universitäten hätte solches Gegengift gut getan und den gelegentlichen Geldsorgen im Haushalt der Rutschkys gewiss besser abgeholfen als eine wöchentliche Kolumne in der "taz".
Der Ton wird düster, aber er wahrt die Integrität des Empirikers, der auch dann nicht aufhört zu beobachten und zu notieren, wenn es seiner Frau, den Tieren und auch ihm selbst schlechter geht. Warum sollte er das beschönigen? Man wird seine Tagebücher gewiss nicht so lesen können, wie Helmut Schmidt Mark Aurel gelesen hat. Rutschky liefert keine Maximen, keine Moral für das Überleben seiner Leserschaft. Der Trauergemeinde, die sich zwei Monate nach seinem Tod im vergangenen Jahr im Restaurant des Hauses der Kulturen der Welt versammelte, lieferte er keine Gelegenheit für Krokodilstränen. Es war eine heiter gelöste Runde. Als Bitternis bleibt nur, dass Kurt Scheel bald darauf sich das Leben nahm. Im Blog "Das Schema" hat er notiert, wie verletzt er sich durch einige Tagebucheinträge gefühlt hat. Zurückhaltender berichtet er davon im Vorwort. Auf dem Totenbett hatte Rutschky ihm das Versprechen abgenommen, den Band für die Drucklegung fertig zu bearbeiten. Warum hat Scheel, der so ein begnadeter Redakteur gewesen ist und selbst Geröllberge in lesbare Texte zu verwandeln half, die kühle Seite des Empirikers Rutschky so unterschätzen können? Der Erfahrungshunger zeigt auch zum Ende hin keine Spur von Sentimentalität. Die Trauerarbeit über das, was der Fall ist, bleibt beim lakonischen Ton. Wenn man das Foto der Tagebucheinträge sieht, scheint die Füllerfeder mittelbreit gewesen zu sein, für das leichte, geräuschlose Gleiten auf den Seiten der Kladden. Aber dieses Schreiben, das keine Zeichen von Eile zeigt, wirkt so, als verwandelte sein Autor sich in eine abgründige Figur von Patricia Highsmith. Ediths Tagebuch lässt grüßen.
Rutschky hat die Notate weitgehend selbst noch transkribiert. Dieser Vorgang hat die analytische Kur des Erinnerns, Wiederholens und Durcharbeitens dupliziert. Er gibt keine Erklärung für größere Lücken. Rutschky beschreibt seine Gemütszustände deutlich genug. Bedrückend ist die Härte, mit der er die Nöte seiner Frau beschreibt. Die Konkurrenz zwischen ihnen muss beide gepeinigt haben. Die Schilderung finanzieller Probleme zeigt ihn als Kassenwart, der um keinen Preis die eiserne Reserve des Sparbuchs angreifen will, um seiner Frau auszuhelfen. Der Ton und die Härte der Einträge sind wie eine mimetische Einübung in das Verschwinden, als wollte der Autor der Nachwelt, die um ihn trauert, die Ablösung durch Verdruss erleichtern. Gut, dass es in dem Band kein Personenregister gibt!
Es bleiben vom Leben des Autors, Redakteurs und so vielseitigen Ermöglichers nicht nur die Erinnerung an seine Erzählweise, sondern auch einige vorbildliche Routinen als Schutzmauer gegen das Verlorengehen in der Depression: der Lesekreis in der Ansbacher Straße, in dem Max Weber oder Montesquieu gelesen werden, der regelmäßige Besuch des Kinos, der Bilderhunger des Fotografen, der seinen Schatten ablichtet oder das vom Fotoapparat und der Hauskatze verstellte eigene Gesicht.
HANS HÜTT
Michael Rutschky: "Gegen Ende. Tagebuchaufzeichnungen 1996-2009". Berenberg, 360 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
In den Charlottenburger Räumen des "Merkurs" sprang Quarto, der junge Hund Rutschkys, herum, zeigte hündischen Erfahrungshunger, indem er aufgeregt aus dem Fenster spähte. Hätte ein Spatz auf dem Sims gesessen, es wäre um Scheibe, Hund und Vogel geschehen gewesen. Keine Intervention des "Herrchens", als das sich Rutschky gegenüber seinen Hunden auch nie verstand. Er ließ dem Hund seinen Lauf und, gleichmütig, psychoanalytisch geerdet, die damalige Diskussion Revue passieren. Er zeigte, wie sich Aufregung durch Kühle anders erfassen lässt. Der junge Rutschky, gewiss ein Linker, zeigte keinen Enthusiasmus für Formate neuer Klassenkämpfe im Urururgroßmutterland des Kapitalismus. Der junge wie der alte wirkten wie ein Seismograph, der Phänomene des Gleichzeitigen beobachtet, Mikro-Pegelausschläge notiert, ohne Ehrgeiz für vorschnelle Erklärungen, aber mit großer Liebe für beobachtbare Details.
Zu Beginn des dritten Bandes seiner Aufzeichnungen ist der Diarist längst ein etablierter Public Intellectual in den besten frühen Jahren seines sechsten Jahrzehnts. Von der ersten Seite an aber durchzieht ein Ton das Buch, der bei Rutschky überrascht. "Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden", das ist ein Actus-Tragicus-Ton, der vom Totengesicht der Mutter Rutschkys über die todgeweihte Katze in Zeitlupe nach dem hohen Paar der West-Berliner Intellektuellenszene zu greifen beginnt.
Bei der Buchpremiere im Literaturhaus lesen Wegbegleiter und Freunde aus den Tagebüchern, der Erbe Jörg Lau erinnert an eigene Irritationen und die des Rutschky-Freundes und Herausgebers Kurt Scheel. An die Stirnseite des Raumes werden Fotos projiziert, in Großaufnahme eine Doppelseite der Tagebücher. Sie zeigt eine gleichmäßige, aus der Ferne halbwegs lesbar wirkende Handschrift, mit Füller geschrieben, der Schreibfluss weder durch Korrekturen noch durch Nachträge unterbrochen, das Werk eines Routiniers. Wie wählt er aus, was er notiert, was nicht? Mit Füller kann man nicht so schnell schreiben wie mit einer Tastatur. Die langsame Bewegung der Feder in der Hand formt im Notat Einträge, die den Charakter von Urteilen gewinnen, gegen die es keine Berufung gibt. Wer wollte mit welchem Recht Einspruch erheben? Wogegen? Gegen die Beobachtung eines dicken Hinterns, gegen die Geldsorgen der Ehefrau, gegen die minutiöse Schilderung ihrer Schreibprobleme? Der Tagebuchschreiber entscheidet, bevor er zum Schreiben ansetzt, was vom vergangenen Tag zum Thema wird. Je weiter die Lektüre fortschreitet, desto unausweichlicher der Eindruck, dass ihm oft Bosheit die Feder führt.
Schon im ersten Band der Tagebücher bemerkt der junge Rutschky mit seltsamer Genugtuung, dass gleichaltrige oder jüngere Männer um ihre Hüften zulegten, während sein männlicher Leib noch hinreichend fest wirkte. Der männliche Leib findet im dritten Band tiefere Aufmerksamkeit. Sie fräst sich aus den Träumen in Tagträume und offenes Begehren. Rutschky liefert mit diesen Einträgen ein spätes Coming-out. Der soignierte ältere Herr verwandelt sich in einen Wiedergänger Gustav von Aschenbachs. Das wirkt bei einem Autor, der durch die eigene Psychoanalyse und sein essayistisches Werk so viel mitzuteilen und zu beobachten gegeben hat, wie eine reverse operation, jetzt wird die Spule zurückgedreht, als hieße die Devise dafür: Wo Ich war, soll Es werden. Minutiös beschreibt er Fotografien, die ihn vor dem Spiegel zeigen, und autoerotische Fotografien, die den spät aufblühenden Narzissmus technisch erzählbar machen. Aus dem Freundeskreis schildert er eine Männerbeziehung, bei der er im Unklaren lässt, ob sie für ihn ein Rollenmodell sein könnte.
Mit äußerster Diskretion, im Tonfall resolut bitter, beschreibt er einen anderen Sachverhalt, der sich wie das Protokoll einer Kränkung lesen lässt. In den Zeitraum von 1996 bis 2009 fallen zwei Gastaufenthalte Rutschkys, einer in Heidelberg, ein anderer in Bamberg. Einflussreiche Freunde werden namentlich erwähnt, die sich für ihn hätten einsetzen können. Warum aber, in Dreiteufelsnamen!, hat keine namhafte deutsche Stiftung, kein geistes- oder sozialwissenschaftlicher Fachbereich Rutschky zu einer Sinecure-Professur für die Neuerfindung eines Studium generale verholfen? Der Bolognese-Verflachung der Universitäten hätte solches Gegengift gut getan und den gelegentlichen Geldsorgen im Haushalt der Rutschkys gewiss besser abgeholfen als eine wöchentliche Kolumne in der "taz".
Der Ton wird düster, aber er wahrt die Integrität des Empirikers, der auch dann nicht aufhört zu beobachten und zu notieren, wenn es seiner Frau, den Tieren und auch ihm selbst schlechter geht. Warum sollte er das beschönigen? Man wird seine Tagebücher gewiss nicht so lesen können, wie Helmut Schmidt Mark Aurel gelesen hat. Rutschky liefert keine Maximen, keine Moral für das Überleben seiner Leserschaft. Der Trauergemeinde, die sich zwei Monate nach seinem Tod im vergangenen Jahr im Restaurant des Hauses der Kulturen der Welt versammelte, lieferte er keine Gelegenheit für Krokodilstränen. Es war eine heiter gelöste Runde. Als Bitternis bleibt nur, dass Kurt Scheel bald darauf sich das Leben nahm. Im Blog "Das Schema" hat er notiert, wie verletzt er sich durch einige Tagebucheinträge gefühlt hat. Zurückhaltender berichtet er davon im Vorwort. Auf dem Totenbett hatte Rutschky ihm das Versprechen abgenommen, den Band für die Drucklegung fertig zu bearbeiten. Warum hat Scheel, der so ein begnadeter Redakteur gewesen ist und selbst Geröllberge in lesbare Texte zu verwandeln half, die kühle Seite des Empirikers Rutschky so unterschätzen können? Der Erfahrungshunger zeigt auch zum Ende hin keine Spur von Sentimentalität. Die Trauerarbeit über das, was der Fall ist, bleibt beim lakonischen Ton. Wenn man das Foto der Tagebucheinträge sieht, scheint die Füllerfeder mittelbreit gewesen zu sein, für das leichte, geräuschlose Gleiten auf den Seiten der Kladden. Aber dieses Schreiben, das keine Zeichen von Eile zeigt, wirkt so, als verwandelte sein Autor sich in eine abgründige Figur von Patricia Highsmith. Ediths Tagebuch lässt grüßen.
Rutschky hat die Notate weitgehend selbst noch transkribiert. Dieser Vorgang hat die analytische Kur des Erinnerns, Wiederholens und Durcharbeitens dupliziert. Er gibt keine Erklärung für größere Lücken. Rutschky beschreibt seine Gemütszustände deutlich genug. Bedrückend ist die Härte, mit der er die Nöte seiner Frau beschreibt. Die Konkurrenz zwischen ihnen muss beide gepeinigt haben. Die Schilderung finanzieller Probleme zeigt ihn als Kassenwart, der um keinen Preis die eiserne Reserve des Sparbuchs angreifen will, um seiner Frau auszuhelfen. Der Ton und die Härte der Einträge sind wie eine mimetische Einübung in das Verschwinden, als wollte der Autor der Nachwelt, die um ihn trauert, die Ablösung durch Verdruss erleichtern. Gut, dass es in dem Band kein Personenregister gibt!
Es bleiben vom Leben des Autors, Redakteurs und so vielseitigen Ermöglichers nicht nur die Erinnerung an seine Erzählweise, sondern auch einige vorbildliche Routinen als Schutzmauer gegen das Verlorengehen in der Depression: der Lesekreis in der Ansbacher Straße, in dem Max Weber oder Montesquieu gelesen werden, der regelmäßige Besuch des Kinos, der Bilderhunger des Fotografen, der seinen Schatten ablichtet oder das vom Fotoapparat und der Hauskatze verstellte eigene Gesicht.
HANS HÜTT
Michael Rutschky: "Gegen Ende. Tagebuchaufzeichnungen 1996-2009". Berenberg, 360 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Harry Nutt liest den dritten Band von Michael Rutschkys Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1996-2009 mit dem "unentschieden-soziologischen" Blick des Autors. So erscheinen die Texte ihm aufregend und verstörend zugleich. Verstörend findet er die auffällige Häufung von Krankheit und Tod, Depression und Düsternis. Aufregend wiederum, wie Rutschky diese Dunkelheit erzählerisch bzw. soziologisch und mit feiner Ironie zu bannen weiß und zum Leuchten bringt. Das Buch ist für Nutt auch ein Wimmelbild der Berliner Boheme, das sich der Rezensent mit Respekt und ein bisschen Furcht anschaut.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für