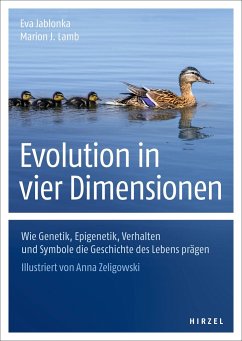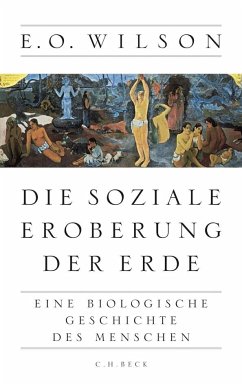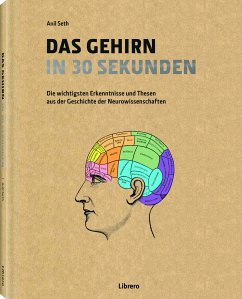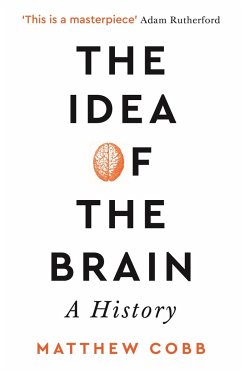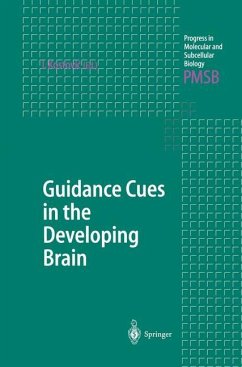Nicht lieferbar

Gehirn und Genom
Ein neues Drehbuch für die Evolution
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Evolution und ihre Theorie benötigen ein neues Drehbuch. Zufall, strukturelle Zwänge und das Treiben "egoistischer Gene" erklären nicht alles. Das Auftreten des menschlichen Gehirns auf der Bühne der Evolution stellt eine Zäsur dar. Seitdem haben das Stück und seine Inszenierung entscheidende Dimensionen hinzugewonnen.Die Evolution des Menschen vollzog sich zwar auf genetischer Grundlage, läßt sich aber dadurch allein nicht hinreichend erklären. Erbgut und Gehirn trugen und tragen auf je eigene, durchaus konkurrierende Weise zur Dynamik des evolutionären Geschehens bei. Schon in ...
Die Evolution und ihre Theorie benötigen ein neues Drehbuch. Zufall, strukturelle Zwänge und das Treiben "egoistischer Gene" erklären nicht alles. Das Auftreten des menschlichen Gehirns auf der Bühne der Evolution stellt eine Zäsur dar. Seitdem haben das Stück und seine Inszenierung entscheidende Dimensionen hinzugewonnen.
Die Evolution des Menschen vollzog sich zwar auf genetischer Grundlage, läßt sich aber dadurch allein nicht hinreichend erklären. Erbgut und Gehirn trugen und tragen auf je eigene, durchaus konkurrierende Weise zur Dynamik des evolutionären Geschehens bei. Schon in ihren zeitlichen Dimensionen unterscheiden sie sich gewaltig. Der Beitrag des Genoms zur Evolution wird in Tausenden bis Millionen von Jahren oder in Hunderten bis Tausenden von Generationen gemessen, der Beitrag des Gehirns jedoch in Minuten, Tagen, Jahren bzw. in einer einzigen Generation. Das Menschengehirn ist in der Lage, aus seinen Auseinandersetzungen mit der Umwelt etwas ganz anderes zu machen als die Erbanlagen. Die Mehrzahl seiner Hervorbringungen sind autonome Leistungen, für die das Genom keine Anweisungen parat hat. Der international renommierte Evolutionsbiologe Wolfgang Wieser zeichnet ein neues, revolutionäres Bild der Evolution, in der neben dem egoistischen Gen das Gehirn die zweite Hauptrolle spielt und es auch auf die Vererbung erworbener Eigenschaften ankommt.
Die Evolution des Menschen vollzog sich zwar auf genetischer Grundlage, läßt sich aber dadurch allein nicht hinreichend erklären. Erbgut und Gehirn trugen und tragen auf je eigene, durchaus konkurrierende Weise zur Dynamik des evolutionären Geschehens bei. Schon in ihren zeitlichen Dimensionen unterscheiden sie sich gewaltig. Der Beitrag des Genoms zur Evolution wird in Tausenden bis Millionen von Jahren oder in Hunderten bis Tausenden von Generationen gemessen, der Beitrag des Gehirns jedoch in Minuten, Tagen, Jahren bzw. in einer einzigen Generation. Das Menschengehirn ist in der Lage, aus seinen Auseinandersetzungen mit der Umwelt etwas ganz anderes zu machen als die Erbanlagen. Die Mehrzahl seiner Hervorbringungen sind autonome Leistungen, für die das Genom keine Anweisungen parat hat. Der international renommierte Evolutionsbiologe Wolfgang Wieser zeichnet ein neues, revolutionäres Bild der Evolution, in der neben dem egoistischen Gen das Gehirn die zweite Hauptrolle spielt und es auch auf die Vererbung erworbener Eigenschaften ankommt.