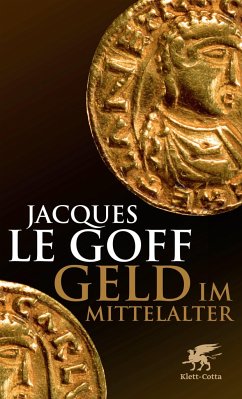Auszahlung am Jüngsten Tag: Als Geben noch seliger war als Nehmen.
Im Mittelpunkt des ökonomischen Denkensstand im Mittelalter die Gabe, nicht der Profit. Auch Händler und Bankiers sorgten sich zuerst um ihr Seelenheil. Am Beispieldes Geldes zeigt Le Goff, dass die Menschen im Mittelalter fundamental anders dachten und handelten.
Den Menschen des frühen Mittelalters war die Idee des Geldes als eines flexiblen, dauerhaften und leicht teilbaren Zahlungsmittels unbekannt.
Nach dem Zusammenbruch des antiken Geldsystems entstanden zwar an einigen Orten regional gültige Kleinwährungen, und im Hochmittelalter kamen auch Bauern gelegentlich mit Münzgeld in Kontakt.
Doch vor dem 13. Jahrhundert wäre ein Bauer nicht auf die Idee gekommen, Münzen als Wertvorrat zu vergraben - was in der Antike auch auf dem Land nicht ungewöhnlich gewesen war. Nicht zwischen materiell Armen und Reichen verläuft im Mittelalter zunächst der entscheidende soziale Unterschied, sondern zwischenhohem und niederem Stand.
Im ausgehenden Mittelalter nimmt die Bedeutung des Geldes zu: in der konkreten Ökonomie ebenso wie in den Köpfen der Menschen. Damit kann der wirtschaftliche Wandel einsetzen.
Im Mittelpunkt des ökonomischen Denkensstand im Mittelalter die Gabe, nicht der Profit. Auch Händler und Bankiers sorgten sich zuerst um ihr Seelenheil. Am Beispieldes Geldes zeigt Le Goff, dass die Menschen im Mittelalter fundamental anders dachten und handelten.
Den Menschen des frühen Mittelalters war die Idee des Geldes als eines flexiblen, dauerhaften und leicht teilbaren Zahlungsmittels unbekannt.
Nach dem Zusammenbruch des antiken Geldsystems entstanden zwar an einigen Orten regional gültige Kleinwährungen, und im Hochmittelalter kamen auch Bauern gelegentlich mit Münzgeld in Kontakt.
Doch vor dem 13. Jahrhundert wäre ein Bauer nicht auf die Idee gekommen, Münzen als Wertvorrat zu vergraben - was in der Antike auch auf dem Land nicht ungewöhnlich gewesen war. Nicht zwischen materiell Armen und Reichen verläuft im Mittelalter zunächst der entscheidende soziale Unterschied, sondern zwischenhohem und niederem Stand.
Im ausgehenden Mittelalter nimmt die Bedeutung des Geldes zu: in der konkreten Ökonomie ebenso wie in den Köpfen der Menschen. Damit kann der wirtschaftliche Wandel einsetzen.

Schulden hatte die öffentliche Hand schon vor einigen hundert Jahren. Nur war der Kapitalismus nicht schuld daran. Jacques Le Goff bringt seine Erforschung der Rolle des Geldes im Mittelalter mit einer Revision zum Abschluss.
Dass die Liebe der Frauen die Männer erlöst, ist keine neue Erfahrung. Als aber der Zisterzienser Caesarius im Siebengebirge um 1200 darüber predigte, bot er noch eine andere Geschichte. Kürzlich sei in Lüttich ein Wucherer gestorben, der den kirchlichen Bestimmungen gemäß kein Grab in geweihter Erde erhalten konnte. Seine Witwe habe dagegen mehrfach beim Papst geklagt: "Steht nicht geschrieben, hoher Herr", hielt sie dem Pontifex vor, "dass Mann und Frau ein Fleisch sind und dass, wie der Apostel sagt, der ungläubige Mann von seiner gläubigen Frau gerettet werden kann? Was mein Mann versäumte zu tun, werde ich - die ich von seinem Fleische bin - statt seiner tun." Die fromme Witwe setzte sich durch, durfte den Verstorbenen umbetten und neben seinem Grab eine Klause für sich errichten, in der sie für ihn mit Almosen, Fasten, Gebeten und Nachtwachen Buße tat. Nach sieben Jahren sei er ihr im schwarzen Gewand erschienen, um mitzuteilen, dass er von den schrecklichsten Qualen der Hölle befreit sei, aber weitere sieben Jahre dauerte es noch, bis er weiß gewandet als Bürger des Himmels vor sie treten konnte.
Der bilderreiche Aufwand, den der Mönch von Heisterbach mit seiner Erzählung trieb, ist begreiflich, hatte er doch eine neue Lehre der Kirche zu vermitteln. Nur wer den Zins zurückzahlte, konnte gerettet werden, hatte bisher gegolten. Jetzt aber sollten den Wucherer auch gute Werke rechtfertigen, selbst wenn sie andere für ihn taten. Mit der Duldung des Zinses rehabilitierte die lateinische Kirche das Geld selbst und ebnete, auch wenn es sich um keinen geradlinigen Prozess handelte, dem Aufschwung der Geldwirtschaft im langen dreizehnten Jahrhundert den Weg. Wie tiefgreifend die Umwertung der Werte und die Mutation der Mentalitäten waren, kann man daran ermessen, dass die Bibel ganz anderes lehrte. "Wer Geld liebhat, der bleibt nicht ohne Sünde; und wer Gewinn sucht, wird daran zugrunde gehen", heißt es schon im alttestamentlichen Buch Jesus Sirach; und der Evangelist Matthäus hatte diejenigen, die Christus folgen wollten, gewarnt: "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon."
Jacques Le Goff hatte sich vor fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal mit "Wucherzins und Höllenqualen" beschäftigt und damals in Zeugnissen wie den Wundergeschichten des Caesarius Anzeichen für ein neues ökonomisches System mit einem massiven Gebrauch von Praktiken gesehen, die die Kirche jahrhundertelang verdammt hatte, für den Kapitalismus. Sein neues Buch, mit dem er seine Reflexionen über das Thema abschließen will, dementiert diese These: Vor dem sechzehnten Jahrhundert könne man nicht vom Kapitalismus sprechen, aber die Geldwirtschaft sei doch auch ein Teil der Feudalgesellschaft in der vorangegangenen Zeit gewesen.
Eindrucksvoll ist die Fülle der Quellen, mit denen Le Goff die Bedeutung des Geldes seit dem Hochmittelalter belegt. Riesig war der Finanzbedarf, um die Handwerker der monumentalen gotischen Kathedralen zu bezahlen; Geld war der Mörtel für die Verteidigungsanlagen, Markthallen, Kanäle und Brunnen der Städte, es verhalf ihren reichen Bürgern zur Selbstdarstellung und den armen Bewohnern zum Kauf ihrer Lebensmittel, für den sie bis zu achtzig Prozent ihres Einkommens aufwenden mussten.
Auch die Bauern waren in den Geldverkehr einbezogen; der Verkauf ihrer Erzeugnisse diente der monetären Ableistung ihrer grundherrlichen Lasten, ermöglichte aber auch den Erwerb jener Geräte, mit denen sich der ertragreiche Anbau von Färberwaid und Hanf bewerkstelligen ließ. Aufkommen und Verbreitung des Familiennamens "Schmied", "favre" oder auch des bretonisch-keltischen "le goff" weisen auf die geldwirtschaftlich bedingte Blüte eines alten Handwerks zurück.
Große Mittel verschlangen Kriege, die mit Söldnerheeren bestritten wurden. Selbst das fromme Unternehmen des dritten Kreuzzugs (1190/92) war ein Test für die Leistungsfähigkeit zentraler Geldbeschaffung. Den englischen Königen Heinrich und Richard gelang der Einzug einer allgemeinen Steuer, der sich auf mehr als hunderttausend Mark belief, aber Frankreichs Philipp August scheiterte mit seinem "Saladinszehnt" und musste Flotte und Ritter mit einer wesentlich schmaleren Kriegskasse finanzieren.
Kaiser Friedrich Barbarossa versuchte gar nicht erst, die Monarchen des Westens zu imitieren; für seinen glänzend vorbereiteten Zug mussten vor allem die Reichsstädte, Reichskirchen und Reichsabteien sowie die oberitalienischen Kommunen bluten; dazu kamen religiös konnotierte Bußgelder. Der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg, der nicht mit nach Jerusalem zog, zahlte allein 2000 Mark, was für die Ausrüstung von 670 Kreuzfahrern langte.
Anscheinend unkontrolliert nahm der Geldbedarf der "öffentlichen Hand" zu. Von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts an sprechen manche Historiker im Hinblick auf die Städte von einer Schuldenspirale; Hamburg und Basel hatten beispielsweise 1362 nur Verbindlichkeiten von einem, ein Jahrhundert später aber schon von fünfzig Prozent ihrer Einkünfte. Die Freie Stadt Mainz war 1447 mit 375 000 Pfund Schulden schon ein hoffnungsloser Fall. Im Unterschied zu den Städten hatten Fürsten und Könige zwar Druckmittel, um immer neue Abgaben einzufordern, aber im Ganzen waren sie im Mittelalter niemals in der Lage, einen Staatshaushalt mit festen Einkünften zu planen. Die Geschichte des modernen Staates hat deswegen im Mittelalter doch noch nicht begonnen.
Trotz seiner reichen Befunde zur Verbreitung von Geldverkehr und Zinswesen nennt Le Goff drei Gründe, weshalb im Mittelalter von Kapitalismus nicht die Rede sein könne: Zum einen sei die Versorgung mit Edelmetall für die Münzherstellung nicht kontinuierlich gesichert gewesen, während Papiergeld, wie es die Chinesen bereits verwendeten, noch nicht bekannt war. Zweitens habe es keinen einheitlichen Markt gegeben, so dass der zersplitterte Münzgebrauch den Fernhandel erschwerte oder zum Erliegen brachte. Schließlich habe noch eine besondere Institution gefehlt, die Börse, die es erst ab 1609 in Europa (Amsterdam) gab.
So weit, so gut. Le Goff geht aber bei seiner Deutung der Epoche noch einen entscheidenden Schritt weiter. Trotz aller beigebrachten Zeugnisse stellt er am Ende fest, das Mittelalter habe das Geld nicht gemocht. Dieses habe sich nämlich letztlich seinem Wertesystem nicht eingefügt, an dessen Spitze die Gerechtigkeit, vor allem aber die "caritas" stand. Da Gott, wie es im ersten Johannesbrief heißt, die Liebe ist und seine Gnade die erste Gabe an die Menschen war, müsse auch das Geld als Gabe und nicht als Mittel zum Profit angesehen worden sein. Wenn andere behauptet haben, dass das Geld "Motor und Zweckbestimmung zwischenmenschlicher Beziehungen" sei (A. Rigaudière), dann habe doch im Mittelalter die Liebe als caritas "das wichtigste gesellschaftliche Bindeglied zwischen dem Menschen und Gott sowie zwischen allen Menschen untereinander" dargestellt. Mit dieser Idealkonkurrenz von Gott und Geld kommt Le Goff dem Urteil des deutschen Soziologen und Philosophen Georg Simmel sehr nahe. In seiner "Philosophie des Geldes" (1900) hatte Simmel auf die "Formähnlichkeit zwischen der höchsten wirtschaftlichen und der höchsten kosmischen Einheit" hingewiesen, die Geld und Gott repräsentierten, und die "Feindseligkeit, mit der die religiöse und kirchliche Gesinnung oft dem Geldwesen gegenübersteht", auf die "erfahrene Gefährlichkeit der Konkurrenz" zurückgeführt, "die gerade das Geldinteresse dem religiösen Leben bereitet".
Für Le Goff hatte sich das Mittelalter zwischen Gott und dem Mammon entschieden. Es war also eine andere, von der unseren gänzlich verschiedene Zeit. Dieses Urteil steht freilich nicht nur im Widerspruch zu dem, was der Autor in seinem Buch selbst geleistet hat; es zeigt vor allem die Signatur eines historischen Denkens an, welches das vergangene Jahrhundert umgetrieben hat, aber nun immer weniger Anklang findet: dass nämlich ganze Zeiträume und Kulturen mit einfachen Labeln voneinander abgetrennt werden können, ja dass ihnen ein "Wesen" eigne, das sie verdammens- oder auch ersehnenswert erscheinen lässt.
MICHAEL BORGOLTE
Jacques Le Goff: "Geld im Mittelalter".
Aus dem Französischen von Caroline Gutberlet. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2011. 279 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Jacques Le Goffs Geldgeschichte des Mittelalters reißt den Rezensenten Michael Stallknecht nicht gerade vom Hocker. Die Kernthese besagt, dass das Mittelalter aufgrund chronischen Mangels an Edelmetallen von Münzknappheit geplagt war, wie Stallknecht zu Protokoll gibt. Die Geldwirtschaft sei zwar spätestens seit dem 13. Jahrhundert in Schwung gekommen, aber der Aufstieg in der gesellschaftlichen Hierarchie sei nach wie vor durch Macht und nicht aufgrund von Reichtum erfolgt. Dass gerade die Kirche die wenigsten Berührungsängste mit Münzgeschäften besaß, Le Goff aber den daraus resultierenden Kontrast zwischen christlicher Lehre und alltäglicher Praxis kaum beachte, enttäuscht den Rezensenten. Denn Stallknecht hatte, auch aufgrund des Klappentextes, eine Fokussierung auf die "Heils- und Gabenökonomie des Mittelalters" erwartet. Insgesamt findet er das Buch trotz der Menge des präsentierten Quellenmaterials "deutungsschwach" und wirft Le Goff zudem vor, über die Forschungsliteratur "grandseigneural hinwegzuwischen".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH