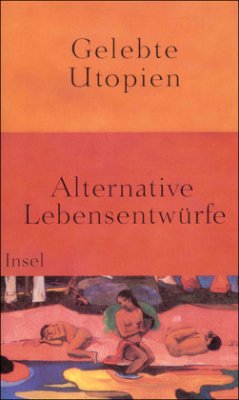Der vorliegende Band stellt die wichtigsten Utopie-Projekte vor, in denen idealen Formen des Arbeitens und Zusammenlebens realisiert und erprobt wurden, erfolgreich oder scheiternd: von den entferntesten Regionen im südindischen Dschungel bis zu den europäischen Stadtkommunen, vom mittelalterlichen Kloster bis zu den Amischen, von den Lebensreform- und Landkommunen (Eden, Monte Veritá) bis zur Hippiebewegung.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Mit diesem Buch haben die Herausgeber ein "gelungenes Lesebuch" zusammengestellt, das so manchen Winterabend verkürzen helfe, aber auch nicht mehr zu bieten habe, wie Rezensent Albrecht Koschorke am Ende seiner Besprechung bemerkt. Der Titel sei bereits paradox und auf die Frage, die damit implizit gestellt werde, inwiefern sich Utopien denn tatsächlich leben ließen, gehe der Text selbst nur kurz ein. Dennoch sind die Utopien, wie Koschorke bemerkt, nicht einfach nur folgenlose Träumereien, sondern haben durchaus selbst in ihrem Scheitern noch Konsequenzen für die Gesellschaft. Die Frage nach den Utopien sei daher sicherlich eine interessante. So werde beispielsweise in einem Beitrag gezeigt, wie aus Love & Peace bei den Hippies Swinger-Partys hervorgingen, wobei sich der Autor auf Houllebecq berufe. Insgesamt bedauert Korschke etwas, dass keine größeren Zusammenhänge zwischen den einzelnen Utopien hergestellt würden und manche Beiträge nicht über einschlägiges Wissen hinausgingen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH