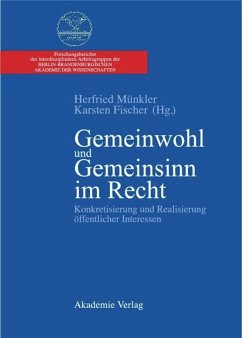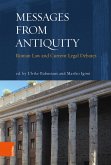Als "Grund und Grenze staatlichen Handelns" (G. F. Schuppert) ist das Gemeinwohl beziehungsweise das öffentliche Interesse als sein gängigster Substitutsbegriff ein zentraler Rechtstopos. Im 3. Band der Edition wird untersucht, wie innerhalb des gesellschaftlichen Funktionssystems Recht das Gemeinwohlideal konkretisiert wird, und welche Erwartungen an den Gemeinsinn hierbei bestehen. Dies lässt sich in historischer Dimension sowie anhand von Analysen verfolgen, die von der Untersuchung der Bundesverfassungsgerichtsjudikatur über einen Vergleich national-verfassungs-staatlicher und europarechtlicher Kontexte bis hin zu völkerrechtlichen und privatrechtlichen Fallstudien reichen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dienen auch Leute von zweifelhaftem Ruf dem Gemeinwohl? Ein neues Großwerk gibt Antwort / Von Friedrich Wilhelm Graf
Johann Heinrich Campe hat in seinem "Wörterbuch der deutschen Sprache" 1808 den "Gemeingeist" erläutert: "ein Geist, der Alle beseelt, der allgemein verbreitet ist, ein lebhafter Sinn für das Gemeinbeste, eine lebhafte und thätige Theilnahme am gemeinen Besten, oder die Richtung des Gemüths und der Handlungen auf das gemeine Beste; auch der Gemeinsinn". Die Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zu "Gemeinwohl und Gemeinsinn" kennt Campes Definition nicht. Aber sie versteht Gemeinsinn ganz in seinem Sinne "als eine motivationale Handlungsdisposition von Bürgern und politisch-gesellschaftlichen Akteuren", die sich am normativen Ideal eines gemeinen Wohls aller orientiert.
Hart gearbeitet haben die Berliner Forscher seit 1998. Vier umfangreiche Bände zeugen von historischem Fleiß und hoher sozialtheoretischer und juristischer Reflexionskraft. Im ersten Band werden die reichen Überlieferungen seit der Antike gesichtet. Gemeinwohl und Gemeinsinn stellen in allen europäischen Gesellschaften Grundbegriffe der politisch-sozialen Sprache dar. Die ursprünglich antiken Konzepte wurden bis heute mit immer neuen Bedeutungsgehalten gefüllt. Der Mangel an semantischer Eindeutigkeit erlaubte es konkurrierenden Gruppen, ihre je besonderen Ziele für allgemeingültig zu erklären. Niemand wollte bloß Eigeninteressen verfolgen. Jeder erklärte, vorrangig dem bonum commune zu dienen. Gemeinwohlrhetorik provozierte deshalb früh schon die Kritik, nur Herrschaft zu legitimieren. Doch wurde Herrschaft in überkommenen Gemeinwohldiskursen auch begrenzt. Immer war die Auslegung des Begriffs von hohen Ambivalenzen geprägt. Sie sind nichts spezifisch Modernes. Otto Gerhard Oexle weist gegen romantisierende Bilder von mittelalterlicher Einheitskultur darauf hin, daß "die vielbeklagte Desintegration der Normalfall auch vormoderner Gesellschaften war". Die Gemeinwesen des Mittelalters seien keineswegs durch eine von allen ständischen Gruppen geteilte christliche Sinnperspektive erfolgreich integriert worden.
Nicht religiös fundierter Konsens, sondern Konflikte prägten auch die Debatten im Übergang zur Moderne. In Fallstudien zum gemeinen Nutzen in Reformation und Früher Neuzeit wird ein tiefgreifender Normenwandel sichtbar. Eigennutzstreben wurde allmählich zu einer moralisch legitimen Einstellung des Bürgers aufgewertet. Dank Melanchthons Neoaristotelismus hatten im lutherischen Deutschland Entwürfe des gemeinen Nutzens zwar hohe Konjunktur. So erklärte Johann Ferrarius 1533 im "Tractatus de respublica bene instituenda - Das ist ein sehr nützlicher Traktat vom Gemeinen Nutzen": "Ist zu wissen, das res publica oder Gemeinnutz nit anders ist dann ein gemein gute ordnung einer Stadt oder einer andern Kommun, darein allein gesucht wird, daß einer neben dem andern bleiben kunde und sich desto stattlicher mit aufrichtigem unverweislichem Wandel im Frieden erhalten. Und wurd darum der Gemeinnutz genannt, daß in dem Fall keiner auf sein eigen Sache allein sehen soll."
Nur dreißig Jahre später konnte der protestantische Jurist Leonhard Fronsberger aber schon "Von dem Lob des Eigen Nutzen" sagen: "Es ist nie kein gemeiner, sondern je und allweg nur ein eigener Nutzen gewesen." Fronsberger wollte sozialen Frieden nicht mehr über religiöse Naturrechtsnormen, sondern durch die allein an die Schranken des positiven Rechts gebundene Verfolgung des Eigennutzes sichern. Damit markierte er einen tiefen Einschnitt in der Deutung des Begriffs, galt blanke Eigennutzorientierung den Ethikern traditionell doch als Sünde.
Lutherische Theologen hatten in ihren Ständeethiken die Arbeit fürs Gemeinwohl zum weltlichen Beruf des Christen erklärt. Jeder Stand sei zur Friedenssicherung und Wohlfahrtssteigerung des Gemeinwesens verpflichtet. Fronsberger hingegen befreite den Eigennutz vom moralischen Makel, der ihm in der stoisch-christlichen Naturrechtsüberlieferung anhaftete. Bernard Mandeville deutete in der "Bienenfabel" dann private vices als public virtues. Doch trotz dieses "semantischen Coups des Liberalismus" - so Karsten Fischer und Herfried Münkler - blieb die Aufwertung des Eigennutzes umstritten. Dank des alten christlichen Ethos von Dienst und Nächstenliebe gilt es vielen Bürgern noch immer als anstößig, sich ausschließlich am individuellen Nutzen zu orientieren.
Die weiteren Bände bieten gewichtige Beiträge zur sozialwissenschaftlichen und juristischen Debatte. Im Zentrum steht die Frage: Läßt sich unter den Bedingungen einer modernen pluralistischen Gesellschaft überhaupt ein normativer Gemeinwohlbegriff bewahren, der praktische Orientierungskraft zu entfalten vermag? Die liberale Ökonomik und Theorie des Politischen bestreiten dies. Den emphatischen Individualismus klassisch liberaler Theoretiker von Adam Smith bis hin zu Mancur Olson sehen viele Berliner Forscher kritisch. Der Mensch sei mehr als nur ein zweckrationaler Interessenagent, der allein seinen privaten Nutzen maximieren wolle.
Für sie bedürfen auch moderne Konfliktgesellschaften einer regulativen Idee des Gemeinwohls. Doch wollen sie dieses Gemeinwohl nicht mehr substantiell, als gegebenes Ensemble fester Verbindlichkeiten bestimmen. Sie operieren mit einer minimalistischen Definition: "Gemeinwohl zielt als Begriff auf gemeinsame Ziele, Kooperationseffekte und ein Handeln, das auf den Erhalt der jeweiligen Gemeinschaft und die Reproduktion ihrer Voraussetzungen gerichtet ist." Der Gemeinschaftsbegriff bleibt hier irritierend vage. Dient alles Handeln zugunsten einer bestimmten Gruppe wirklich dem Gemeinwohl? Agieren Mafiosi gemeinwohldienlich, wenn sie im Sinne ihres Ehrenkodex Verschwiegenheit auch mit Waffengewalt durchsetzen? Oder verletzt ihre spezifische Gemeinschaftsorientierung das gemeine Wohl Italiens? Die modernitätsspezifische Ablösung des Gemeinwohlbegriffs von normativen ethischen Gehalten führt in den Zirkel, fürs Gemeinwohl auf Gemeinsinn und für Gemeinsinn auf intersubjektiv geteilten normativen Sinn rekurrieren zu müssen. Tätiges Interesse am Gemeinwohl setzt eine Motivation zu Gemeinsinn voraus. Wie bildet sich jedoch Gemeinsinn?
Zur "Aktivierung von Gemeinwohlpostulaten spielt die Größe der Bezugsgruppe (Gemeinde, Region, Nationalstaat, EU)" eine wichtige Rolle. Je größer, bürgerferner die "Bezugsgruppe", desto brüchiger wird ein kommunitärer Bindungsgehalt. Transparenz wird erschwert, indem die vielen runden Tische klassische Institutionen politischer Willensbildung, insbesondere das Parlament, schwächen. Dient Gemeinwohlrhetorik nur zur Legitimation eines Verbändestaates, der von klassischen Republikidealen so weit entfernt ist wie ein Fertighaus von einer Palladio-Villa?
Die Berliner Bände sind das mit großem Abstand Beste, was man seit langem zum Gemeinwohldiskurs lesen kann. Gut sichtbar werden die sprachlichen Strategien, mit denen viele Akteure ihre Ansprüche so artikulieren, daß sie als Förderung des gemeinen Wohls aller erscheinen. Darin sehen die Berliner Forscher nichts Verwerfliches. Alle Akteure müßten ihre partikularen Forderungen als systemförderliche Leistung empfehlen, wollten sie wegen des Verzichts auf Gemeinwohlrhetorik nicht ins Abseits gedrängt werden. Sind Gemeinwohlformeln nur eine Funktion effizienterer Durchsetzung partikularer Interessen? Münkler und Harald Bluhm bestreiten dies und erkennen dem Rhetorischen eine eigene Bindungskraft zu. Wer sich aufs Gemeinwohl berufe, setze sich selbst unter Druck, ihm zu entsprechen, "und im Rahmen dieser Selbstbindungswirkung erzwingt eine strategisch intendierte Gemeinwohlrhetorik eine tatsächliche Gemeinwohlorientierung". Doch wer entscheidet, was als "tatsächliche Gemeinwohlorientierung" gilt? Wie läßt sich jenseits sprachlicher Konventionen ein faktisches Gemeinwohl denken, wenn über Rechtsgehorsam und Legalität hinaus von freien Bürgern nichts Moralisches soll eingeklagt werden dürfen?
Viele Autoren betonen, daß man ohne bürgerliche Tugenden keine demokratischen Institutionen bauen kann. Kants Überzeugung, der Rechtsstaat funktioniere auch mit einem Volk vernünftiger Teufel, erklären sie zu einer Illusion. So suchen sie nach dem tugendhaften Bürger, der sich fürs Gemeinwesen engagiert. In einer bisweilen widersprüchlichen Verknüpfung aristotelischer Reflexionsfiguren mit "deliberativen" Argumenten John Deweys oder Jürgen Habermas' werden dritte Wege zwischen starkem Tugendstaat und liberalem Laisser-faire skizziert. Der Zirkel, fürs Gemeinwohl vom Bürger Gemeinsinn erwarten zu müssen, aber diese "subjektive Seite" des Verantwortungsethos nicht über bestimmte Normativität stärken zu können, läßt sich mit eklektizistischem "Theoriedesign" indes kaum verhüllen. Indem die politische Theorie und Moralphilosophie Zusammenhänge zwischen Norm und Motivation auflösen, verstricken sie sich in eine hilflose Sollensrhetorik.
Leider fehlen Beiträge zur Frage nach der ethischen Bildungskraft religiöser Institutionen. Bürgertugend läßt sich nur in Institutionen bilden, die alteuropäische ethische Überlieferungen pflegen. Die reflektierte Distanz zur eigenen Unmittelbarkeit, die für Gemeinsinn vorausgesetzt wird, entsteht nicht von selbst, sondern muß in Bildungsprozessen erarbeitet werden. Dazu bedarf es eines realistischen Blicks auf den Menschen. Entweder sind Gemeinwohl und Gemeinsinn nur ideologische Leerformeln, um Interessen zu kaschieren, oder sie zehren von der christlichen Einsicht, daß sich der ichfixierte Sünder nicht durch eigene Kraft aus seiner incurvatio in se, egozentrischen Selbstbezüglichkeit, zu lösen vermag. Hier bedarf es mehr als nur des wohlmeinenden Appells, auch an die anderen zu denken. Können religiös erinnerungsschwache Bürger überhaupt eine moralische Disposition für Gemeinsinn bilden? Prozedurale Aushandelung allein kann jedenfalls keine starke Motivationskraft entfalten, die "alle beseelt".
Herfried Münkler, Harald Bluhm (Hrsg.): "Gemeinwohl und Gemeinsinn". Historische Semantiken politischer Leitbegriffe.
Herfried Münkler, Karsten Fischer (Hrsg.): "Gemeinwohl und Gemeinsinn". Rhetoriken und Perspektiven sozial-moralischer Orientierung.
Herfried Münkler, Karsten Fischer (Hrsg.): "Gemeinwohl und Gemeinsinn im Recht". Konkretisierung und Realisierung öffentlicher Interessen.
Herfried Münkler, Harald Bluhm (Hrsg.): "Gemeinwohl und Gemeinsinn". Zwischen Normativität und Faktizität. Forschungsberichte der interdisziplinären Arbeitsgruppe "Gemeinwohl und Gemeinsinn" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Bände I-IV. Akademie Verlag, Berlin 2001/2002. Je Band 330 S., geb., jeweils 39,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nach vier Jahren Forschung hat die interdisziplinäre Arbeitsgruppe "Gemeinwohl und Gemeinsinn" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ihre Erkenntnisse in vier Bänden niedergelegt, die Rezensent Friedrich Wilhelm Graf studiert hat. Dabei spannt sich der Bogen von der Geschichte der Begriffe Gemeinwohl und Gemeinsinn von der Antike mit der "res publica" über das Mittelalter bis in die Gegenwart im ersten Band über die rhetorischen Nutzung dieser Begriffe bis hin zu deren Einsatz in der aktuellen Politik, wie Graf bemerkt. Was der Rezensent jedoch vermisst, ist die religiöse Perspektive. Angelehnt an den Versuch der Autoren, aus christlicher und eigennütziger Perspektive eine neue Sicht zu schaffen, argumentiert er, dass dies ohne Vorbildung und die christliche Einsicht in die eigene Hilfsbedürftigkeit nicht möglich ist: "Prozedurale Aushandlung allein kann jedenfalls keine starke Motivationskraft entfalten, die 'alle beseelt'."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH