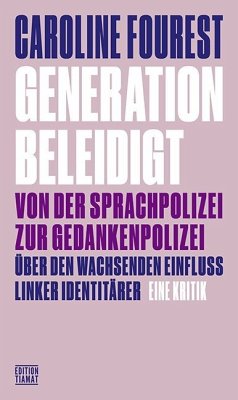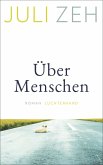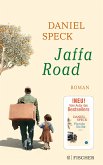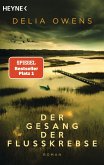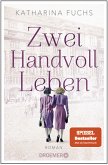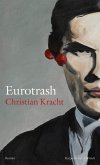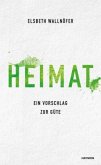Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Harry Nutt liest Caroline Fourests Fallsammlung mit Beispielen aus der linken Identitätspolitik mit Schrecken. Ob Thomas Gottschalk des Blackfacings, eine Yogagruppe der kulturellen Aneignung beschuldigt wird oder das Wort Zigeunerschnitzel auf den Index kommt, die Grenzen zwischen rechter und linker Identitätspolitik sind längst fließend, lernt Nutt bei Fourest. Wie analytisch klar die Autorin den Blick schärft für den Tugendterror, findet Nutt bewundernswert. Lustig ist das alles längst nicht mehr, stellt er fest, auch wenn die Autorin sich in "bittere Ironie" rettet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Caroline Fourest über Strategien der identitären Linken
Hier spricht jemand Klartext. Caroline Fourest räumt mit Verve den öffentlichen Diskurs auf, der vor lauter Empörungsreflexen eine vernünftige Verständigung mittlerweile nahezu unmöglich macht. Längst sind es nicht mehr bloß die Rechtsextremen, die ihr politisches Projekt zu einer Frage der Identität erklären. Auch die Linke ist auf den Geschmack gekommen und führt den Kampf der politischen Hypersensibilisierung.
Die linksidentitäre Selbstbehauptung hat viele Gesichter. Ob es um gendergerechte Sprache geht, Antirassismus, Diversitätsgebote oder Dekolonialisierung - die Praxis der Subsumierung entweder unter die Bösen oder die Guten ist institutionell bereits tief verankert. An der Universität, in der Verwaltung, in Film, Kunst und Medien, überall ist die eigene Identität plötzlich politisch, und sie steht gleich unter Verdacht, wenn sie nicht zu einer als diskriminiert geltenden Minderheit gehört. Die französische Journalistin Caroline Fourest hat diesen identitätspolitischen Verdrehungen eine scharfsinnige Kritik gewidmet.
Fourest, die für "Charlie Hebdo" gearbeitet hat, legt in ihrem Buch ihre Orientierung offen: Sie ist homosexuell und war deshalb etlichen Anfeindungen ausgesetzt. Aber sie wählt nicht den Weg der identifikatorischen Aufladung des Politischen, sondern sieht sich selbst in der Tradition der republikanischen, universalistischen Linken. Wo die eigene Identität als Waffe gegen jegliche Kritik eingesetzt wird, nimmt diese biographische Transparenz der Gegenseite den Wind aus den Segeln.
Fourest erzählt von "Safe Spaces" an Universitäten, die Studenten vor diskriminierenden "Mikroaggressionen" schützen sollen. Aus Sicht der "opferzentrierten Ideologie des Antirassismus" droht diese Gefahr überall: in der Art, wie wir sprechen, in Seminarthemen und Büchern, sogar in der Darstellung von Geschichte, die historisches Unrecht beim Namen nennt. Das führt so weit, dass "segregierte Werkstätten" entstehen, die "Rassifizierte" von "Nicht-Rassifizierten" (den Weißen) trennen. Wer aufgrund seiner Hautfarbe privilegiert ist, gehört ausgeschlossen. Das ist das Diktum einer neuen Linken, die im Namen des Antirassismus rassistische Denkweisen neu festschreibt, nur unter umgekehrtem Vorzeichen: "Sag mir, welcher Herkunft du bist, und ich werde dir sagen, ob du reden darfst!"
Fourest kritisiert die Verharmlosung des politischen Islams und beobachtet die Vorwürfe der "kulturellen Aneignung", die etwa in Kanada so weit gingen, dass Yoga-Kurse boykottiert wurden, aus Angst, sich indische Kultur anzueignen. Sie kritisiert die Forderung von Schauspielern, ihre Herkunft und sexuelle Orientierung bei der Vergabe von Rollen zu berücksichtigen und für eine stärkere Repräsentation unterdrückter Minderheiten zu sorgen. Man müsse nicht das sein, was man spielt. Eine solche Offerte missachte den Geist des Theaters, "das allen Menschen erlaubt, in alle erdenklichen Rollen zu schlüpfen, ohne sich einem DNA-Test zu unterziehen". Sie erkennt, wie "brandgefährlich" die politische Motivation der identitären Linken ist: "Die neue Generation denkt nur daran, zu zensieren, was sie kränkt oder ,beleidigt'." Sie beanspruchten, die Welt von Ungleichheit, Unterdrückung und Ausgrenzung zu befreien, und verfielen dabei einer Doppelmoral, die am Ende genau das forciert, was sie eigentlich bekämpfen will.
Die "politische Korrektheit", schreibt Fourest, sehe der "freiheitsbedrohenden Karikatur immer ähnlicher, die ihre Gegner von jeher gezeichnet haben". Die soziale Frage habe die Linke indessen vollständig aus den Augen verloren. In der Tat sind die aggressiven Debatten zur linken Identitätspolitik keine Themen der Unterschicht; sie entstehen in privilegierten Milieus, welche die Beschränktheit ihrer eigenen Perspektiven nicht wahrhaben wollen. Die identitäre Rechte, warnt Fourest, profitiere am Ende davon. Eine treffendere Analyse wird man so schnell nicht finden.
HANNAH BETHKE.
Caroline Fourest: "Generation beleidigt." Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Eine Kritik.
Aus dem Französischen von A. Carsticuc, M. Feldon, Ch. Hesse. Edition Tiamat, Berlin 2020. 144 S., br. 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main