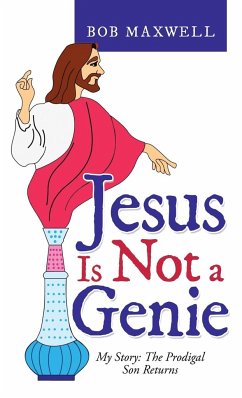Michael Hagner beschreibt die Sammlung und Erforschung der Gehirne bedeutender Persönlichkeiten als eine Geschichte, in der sich wissenschaftliche und kulturelle Aspekte miteinander verschränken.Die Idee, daß Schädel und Gehirne außerordentlicher Persönlichkeiten besondere Eigenschaften aufweisen, reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Genie, Kriminalität und Geisteskrankheit - das war die Trias, deren anatomische, anthropologische und physiognomische Untersuchung eine Grundlage für die Kenntnis des Menschen bilden sollte. Was zunächst als kauzige Schädelbetrachtung begann, wurde alsbald zu einem ambitionierten wissenschaftlichen Programm ausgeweitet.Hagners Leitthese lautet, daß die Gehirne bedeutender Gelehrter, Wissenschaftler und Künstler nicht nur wissenschaftliche, sondern stets auch kulturelle Objekte gewesen sind. Im Umgang mit ihnen kommt immer wieder eine säkularisierte Praxis der Erinnerungskultur zum Ausdruck, die für das Verständnis der Mentalität bedeutender Persönlichkeiten in der Moderne von großer Bedeutung ist. Anhand zahlreicher, vielfach unbekannter Beispiele wird gezeigt, daß die Erforschung außerordentlicher Gehirne von der Kraniologie, Hirnwägung, Lokalisationslehre und Ausmessung der Hirnwindungen über die Cytoarchitektonik bis zum aktuellen Neuroimaging reicht. Dabei sind geniale Gehirne stets in besonderen historischen und wissenschaftlichen Konstellationen bedeutsam geworden: in der Genieverehrung um 1800, in den Debatten um die kulturelle und soziale Bedeutung der Naturwissenschaften nach der 1848er Revolutionszeit, in den Diskussionen um die Natur des Genies im Fin de Siècle, in der politisch hektischen Situation der späten Weimarer Republik und der ersten Jahre des Nationalsozialismus und schließlich in den Brave Neuro Worlds unserer Zeit. Dabei zeigt Hagner, daß die neurophilosophische Grundidee - eine Eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen Gehirn- und geistigen Zuständen - für Gelehrte vor 200 Jahren bereits genauso faszinierend gewesen ist wie für Hirnforscher unserer Tage.Zur Reihe:Die Wissenschaftsgeschichte verstand sich lange Zeit als eine Art Gedächtnis der Wissenschaften. Heute sucht sie ihren Platz in der Kulturgeschichte und sieht ihre Aufgabe nicht zuletzt darin, Brücken zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften zu bauen. Die Formen, in denen dies geschieht, sind keineswegs ausgemacht. Sie sind Gegenstand eines großen, gegenwärtig im Gange befindlichen Experiments. Die historische Einbettung der wissenschaftlichen Erkenntnis, der Blick auf die materielle Kultur der Wissenschaften, auf ihre Objekte und auf die Räume ihrer Darstellung verlangt nach neuen Formen der Reflexion, des Erzählens und der Präsentation. Die von Michael Hagner und Hans-Jörg Rheinberger herausgegebene Reihe »Wissenschaftsgeschichte« versteht sich als ein Forum, auf dem solche Versuche vorgestellt werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

JUNG SIND ALLE Hoffnungen, und die Alten, die sich die Hoffnung bewahren, bleiben gerade dadurch jung. So dürfen wir hier junge Hoffnungen durchaus altersunabhängig definieren - als Autoren, die sich mit einem ersten oder zweiten Werk als Hoffnungsträger am Bücherhimmel profilieren. Wer in dem neuronal kontrollierten Kosmos der Hirnforscher einen Zwischenruf wagt, gibt Anlaß zu der Hoffnung, daß er sich seine Freiheit etwas kosten läßt. Wer zudem wie Michael Hagner einen solchen Zwischenruf auch noch historisch unterfüttern kann, indem er die Hirnforscher über ihre unaufgeklärte Vergangenheit aufklärt, bremst neurowissenschaftliche Mythenbildung hoffnungsvoll ab. Was aber ist Valentin Groebner für eine junge Hoffnung? Groebner zerstört den alten Mythos vom Mittelalter als einer Zeit, in der es noch einen kleinen Grenzverkehr ohne Paß gegeben habe. Mit Steckbrief und Ausweis wurden die Register der Erfassung vielmehr auch damals schon gezogen, da half kein Hoffen und Bangen. Aber von wegen Mittelalter! Selbst in der Antike war es so, daß die Hoffnung zuletzt stirbt, wie Winfried Schmitz für die scharf kontrollierten Faulpelze der damaligen Dorfgemeinschaft herausfand.
gey
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Damit, dass man das Genie im Hirn verortet, ist noch nicht viel erkannt, meint Rezensent Eberhard Ortland. Zum einen sei es ja - zu Lebzeiten - nicht eben einfach, ins Hirn hineinzusehen. Und wie das Genie da hinein oder darin zustande kommt, darauf eine Antwort zu finden, sei alles andere als einfach. Michael Hagner untersucht in seiner Studie die Versuche der Wissenschaft, diese Antwort zu entdecken. Geniehirne wurden im Laufe der Jahrhunderte "abgetastet, vermessen, gesammelt" und in Scheiben geschnitten, immer auf der Suche nach der "Natur des Geistes". Diese Natur, dies nun Hagners entschiedene These und Erkenntnis, ist als wissenschaftliche Vorannahme immer schon eines kulturellen Geistes Kind. Und um diese kulturellen Geister geht es in seiner wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung. Sie hören öfter auf so unschöne Namen wie "Rassismus, Sexismus und Eugenik". Sehr schön aber findet es der Rezensent, dass Hagner in seiner "materialreich dokumentierten und blitzgescheiten Studie" auf die "Denunziation der Neurowissenschaften" verzichtet, dafür aber den "Blick für die historischen Konstellationen" schärft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH