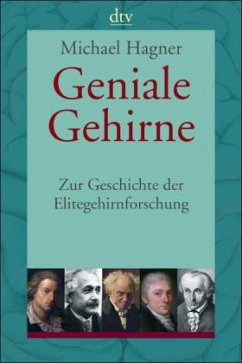Elitegehirnforschung ist sensationsanfällig. Wer hat nicht von Descartes' oder Schillers Schädel, von Lenins oder Einsteins Gehirn und den sich darum rankenden, etwas mysteriösen Geschichten gehört? Michael Hagner entwirrt dieses Sammelsurium an Anekdoten und rekonstruiert die Geschichte der Elitegehirnforschung. Dabei stellt er dar, daß geniale Gehirne nicht nur wissenschaftliche, sondern stets auch kulturelle Objekte sind, die Auskunft geben über diejenigen modernen Gesellschaften, in denen diese Gehirne erforscht werden.

JUNG SIND ALLE Hoffnungen, und die Alten, die sich die Hoffnung bewahren, bleiben gerade dadurch jung. So dürfen wir hier junge Hoffnungen durchaus altersunabhängig definieren - als Autoren, die sich mit einem ersten oder zweiten Werk als Hoffnungsträger am Bücherhimmel profilieren. Wer in dem neuronal kontrollierten Kosmos der Hirnforscher einen Zwischenruf wagt, gibt Anlaß zu der Hoffnung, daß er sich seine Freiheit etwas kosten läßt. Wer zudem wie Michael Hagner einen solchen Zwischenruf auch noch historisch unterfüttern kann, indem er die Hirnforscher über ihre unaufgeklärte Vergangenheit aufklärt, bremst neurowissenschaftliche Mythenbildung hoffnungsvoll ab. Was aber ist Valentin Groebner für eine junge Hoffnung? Groebner zerstört den alten Mythos vom Mittelalter als einer Zeit, in der es noch einen kleinen Grenzverkehr ohne Paß gegeben habe. Mit Steckbrief und Ausweis wurden die Register der Erfassung vielmehr auch damals schon gezogen, da half kein Hoffen und Bangen. Aber von wegen Mittelalter! Selbst in der Antike war es so, daß die Hoffnung zuletzt stirbt, wie Winfried Schmitz für die scharf kontrollierten Faulpelze der damaligen Dorfgemeinschaft herausfand.
gey
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Damit, dass man das Genie im Hirn verortet, ist noch nicht viel erkannt, meint Rezensent Eberhard Ortland. Zum einen sei es ja - zu Lebzeiten - nicht eben einfach, ins Hirn hineinzusehen. Und wie das Genie da hinein oder darin zustande kommt, darauf eine Antwort zu finden, sei alles andere als einfach. Michael Hagner untersucht in seiner Studie die Versuche der Wissenschaft, diese Antwort zu entdecken. Geniehirne wurden im Laufe der Jahrhunderte "abgetastet, vermessen, gesammelt" und in Scheiben geschnitten, immer auf der Suche nach der "Natur des Geistes". Diese Natur, dies nun Hagners entschiedene These und Erkenntnis, ist als wissenschaftliche Vorannahme immer schon eines kulturellen Geistes Kind. Und um diese kulturellen Geister geht es in seiner wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung. Sie hören öfter auf so unschöne Namen wie "Rassismus, Sexismus und Eugenik". Sehr schön aber findet es der Rezensent, dass Hagner in seiner "materialreich dokumentierten und blitzgescheiten Studie" auf die "Denunziation der Neurowissenschaften" verzichtet, dafür aber den "Blick für die historischen Konstellationen" schärft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH