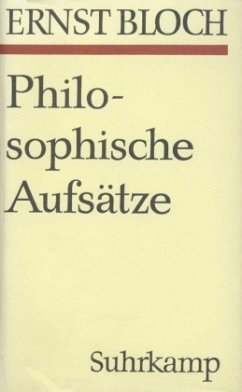Nicht lieferbar
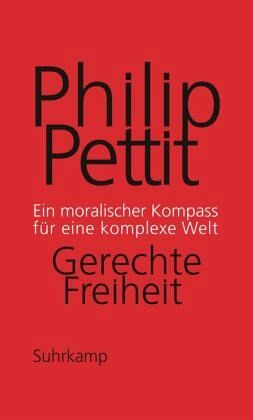
Gerechte Freiheit
Ein moralischer Kompass für eine komplexe Welt
Übersetzung: Wördemann, Karin
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Was heißt Freiheit heute - jenseits einer auf persönliche Interessendurchsetzung zielenden neoliberalen Marktfreiheit? Können wir noch ein Freiheitsverständnis entwickeln, das uns moralische Orientierung in einer immer komplexeren Welt bietet? Philip Pettit, einer der meistdiskutierten Philosophen der Gegenwart, entwickelt in seinem mitreißenden Buch einen Freiheitsbegriff, der die Idee eines nichtbeherrschten Lebens in sein Zentrum stellt. Freiheit heißt ihm zufolge sein eigener Herr sein, allen auf Augenhöhe begegnen können und den Einfluss anderer Menschen nicht fürchten müssen. D...
Was heißt Freiheit heute - jenseits einer auf persönliche Interessendurchsetzung zielenden neoliberalen Marktfreiheit? Können wir noch ein Freiheitsverständnis entwickeln, das uns moralische Orientierung in einer immer komplexeren Welt bietet? Philip Pettit, einer der meistdiskutierten Philosophen der Gegenwart, entwickelt in seinem mitreißenden Buch einen Freiheitsbegriff, der die Idee eines nichtbeherrschten Lebens in sein Zentrum stellt. Freiheit heißt ihm zufolge sein eigener Herr sein, allen auf Augenhöhe begegnen können und den Einfluss anderer Menschen nicht fürchten müssen. Das hat weitreichende soziale, ökonomische und politische Konsequenzen.
Pettit verfolgt diese republikanische Idee der Freiheit von ihrer Entstehung in der Römischen Republik über den Republikanismus der Florentiner Renaissance bis hin zur englischen Revolution der 1640er Jahre und zur amerikanischen Revolution des 18. Jahrhunderts, um sie dann auf brillante Weise zur Lösung aktueller Probleme fruchtbar zu machen. Im sozialen und ökonomischen Bereich ergibt sich daraus die Notwendigkeit weitreichender sozialstaatlicher Interventionen, robuster Arbeitnehmerrechte sowie der Schutz kleiner Unternehmen gegen große Konzerne. Mit Blick auf die Demokratie führt Pettit innovative Überlegungen ein, wie man die Bürger nicht nur über Wahlen als Autoren der Gesetze stärken kann, sondern auch über sogenannte "Kontestationen" von Mehrheitsentscheidungen. Und im Hinblick auf die internationale Politik begründet er, warum Staaten, die ihre Bürger vor Beherrschung schützen, nicht selbst zum Opfer von Beherrschung durch mächtigere Staaten, multinationale Konzerne oder internationale Organisationen werden dürfen. Ein unverzichtbarer Kompass für die Navigation im 21. Jahrhundert.
Pettit verfolgt diese republikanische Idee der Freiheit von ihrer Entstehung in der Römischen Republik über den Republikanismus der Florentiner Renaissance bis hin zur englischen Revolution der 1640er Jahre und zur amerikanischen Revolution des 18. Jahrhunderts, um sie dann auf brillante Weise zur Lösung aktueller Probleme fruchtbar zu machen. Im sozialen und ökonomischen Bereich ergibt sich daraus die Notwendigkeit weitreichender sozialstaatlicher Interventionen, robuster Arbeitnehmerrechte sowie der Schutz kleiner Unternehmen gegen große Konzerne. Mit Blick auf die Demokratie führt Pettit innovative Überlegungen ein, wie man die Bürger nicht nur über Wahlen als Autoren der Gesetze stärken kann, sondern auch über sogenannte "Kontestationen" von Mehrheitsentscheidungen. Und im Hinblick auf die internationale Politik begründet er, warum Staaten, die ihre Bürger vor Beherrschung schützen, nicht selbst zum Opfer von Beherrschung durch mächtigere Staaten, multinationale Konzerne oder internationale Organisationen werden dürfen. Ein unverzichtbarer Kompass für die Navigation im 21. Jahrhundert.