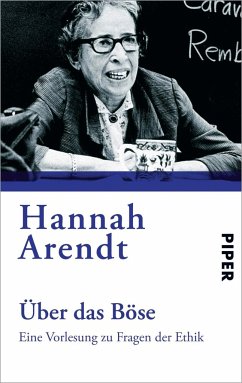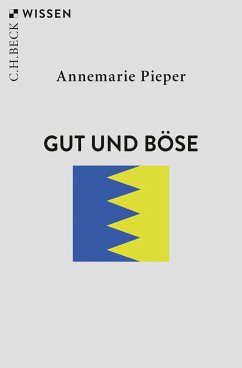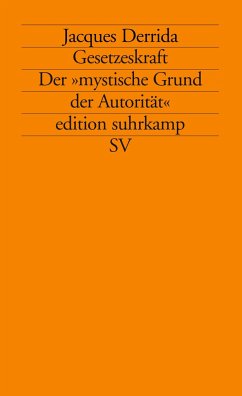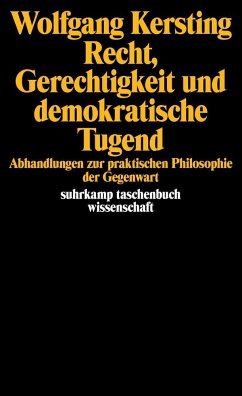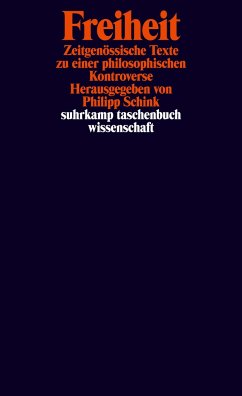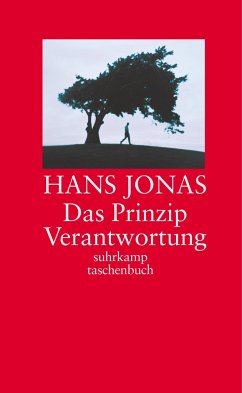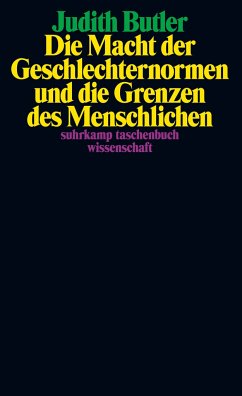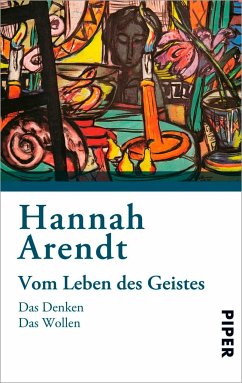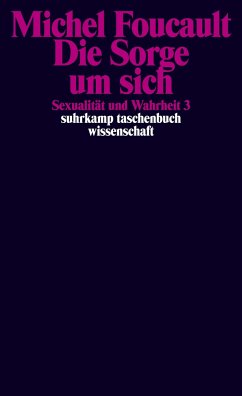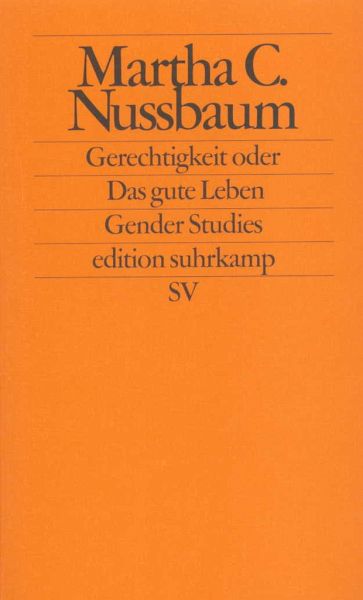
Gerechtigkeit oder Das gute Leben
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Aus den Reflexionen über eine Theorie des Guten gewinnt die Autorin die theoretischen Ressourcen für eine Reformulierung des politischen Liberalismus, die bislang vernachlässigten Problemen wie internationaler Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit Rechnung trägt. In ihrer Ethik des Guten unternimmt Martha C. Nussbaum eine Neudefinition des Begriffs des Wohlergehens und formuliert mit ihrer Theorie des guten Lebens eine Alternative zu den anthropologisch ausgedünnten deontologischen Moralansätzen.