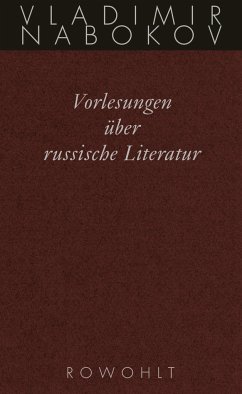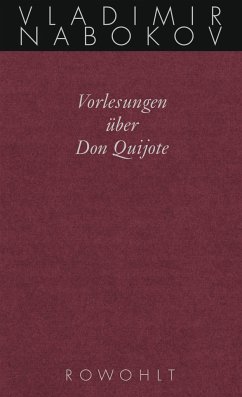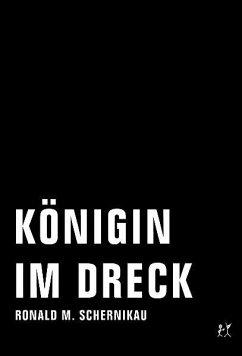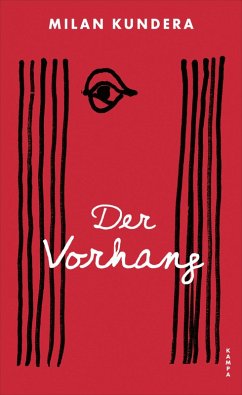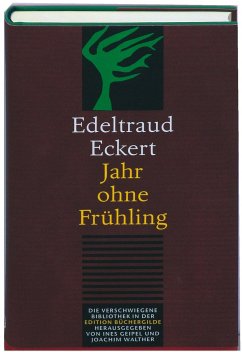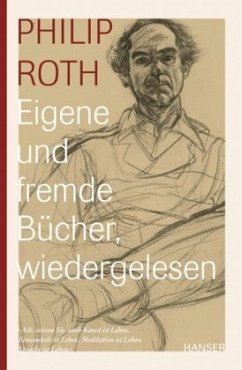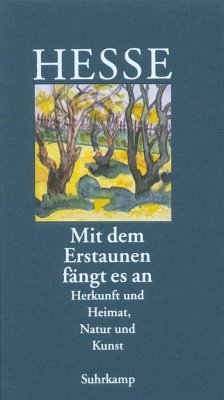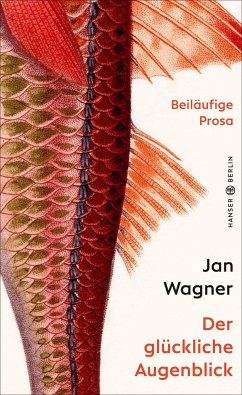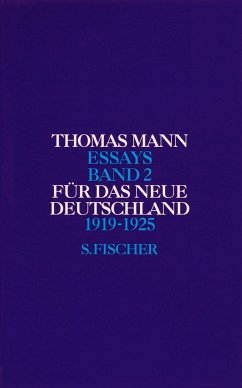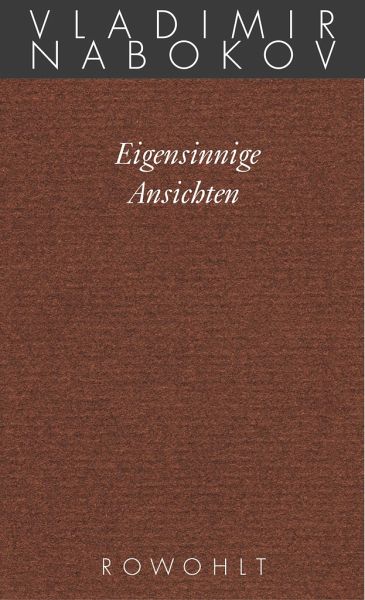
Gesammelte Werke 21. Eigensinnige Ansichten
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gut sechzig Texte Vladimir Nabokovs aus der gesamten Zeit eines russisch-amerikanischen Schriftstellerlebens in fünf Ländern, entstanden zwischen 1921 und 1977, hat Dieter E. Zimmer versammelt: Interviews, Feuilletons, Vorträge, Rezensionen, Nachrufe, Umfrageantworten, Leserbriefe. Sie stammen aus vierzig verschiedenen Quellen, die meisten entlegen und einige nahezu verschollen. Mehrere sind Erstdrucke aus dem Nachlaß. So verschieden die Anlässe dieser Texte, ihr Umfeld, ihr Ton, durchzieht sie dennoch ein roter Faden. Es ist Nabokovs emphatische und unbedingte Liebe zur konkreten Einzelh...
Gut sechzig Texte Vladimir Nabokovs aus der gesamten Zeit eines russisch-amerikanischen Schriftstellerlebens in fünf Ländern, entstanden zwischen 1921 und 1977, hat Dieter E. Zimmer versammelt: Interviews, Feuilletons, Vorträge, Rezensionen, Nachrufe, Umfrageantworten, Leserbriefe. Sie stammen aus vierzig verschiedenen Quellen, die meisten entlegen und einige nahezu verschollen. Mehrere sind Erstdrucke aus dem Nachlaß.
So verschieden die Anlässe dieser Texte, ihr Umfeld, ihr Ton, durchzieht sie dennoch ein roter Faden. Es ist Nabokovs emphatische und unbedingte Liebe zur konkreten Einzelheit und seine Abneigung gegen Verallgemeinerungen, Allgemeinbegriffe, Klischees. "Eigensinnige Anisichten" ergänz Nabokovs eigene Sammlung "Deutliche Worte" (1973) und weitet gleichzeitig deren zeitlichen, räumlichen und thematischen Rahmen.
So verschieden die Anlässe dieser Texte, ihr Umfeld, ihr Ton, durchzieht sie dennoch ein roter Faden. Es ist Nabokovs emphatische und unbedingte Liebe zur konkreten Einzelheit und seine Abneigung gegen Verallgemeinerungen, Allgemeinbegriffe, Klischees. "Eigensinnige Anisichten" ergänz Nabokovs eigene Sammlung "Deutliche Worte" (1973) und weitet gleichzeitig deren zeitlichen, räumlichen und thematischen Rahmen.